E-MAIL
info@smart-rail-campus.de
Workstreams zum ConferenceDay - 17.09.2025
Tagungsort:
Evangelische Schulgemeinschaft Erzgebirge
Straße der Freundschaft 11
09456 Annaberg-Buchholz
Evangelische Schulgemeinschaft Erzgebirge
Straße der Freundschaft 11
09456 Annaberg-Buchholz
Workstreams Slot A - Zeit: 09:45 - 11:45
A01 - Boldyn Networks Deutschland AG
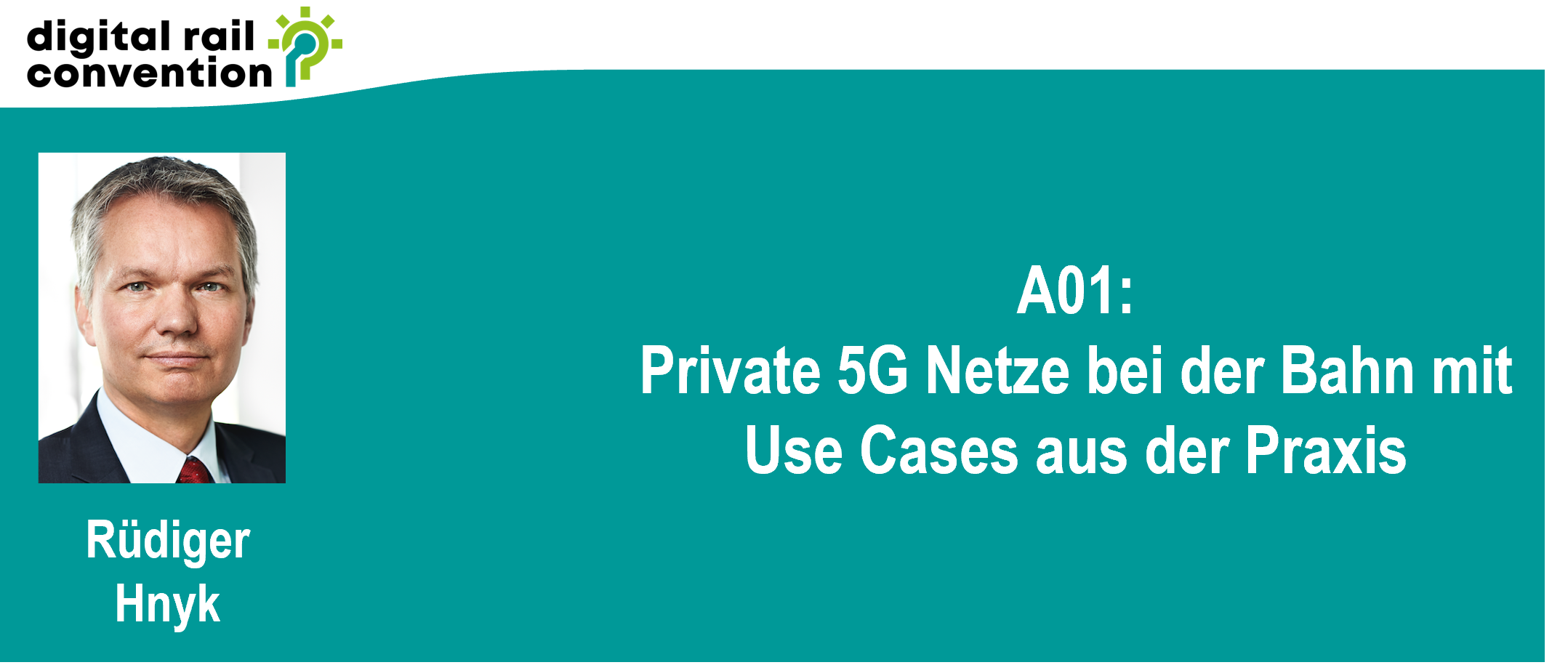
Workstream-Owner:
Rüdiger Hnyk - Boldyn Networks Deutschland AG
After working in many larger companies like SIEMENS/NOKIA, Deutsche
TELEKOM, Microsoft and SONY, Ruediger helped Peer-to-Peer streaming leader Octoshape, Denmark to grow their business in Europe as part of the management team. Octoshape was then acquired by streaming leader Akamai in April 2015.
Thereafter, Ruediger joined Smart Mobile Labs AG in Munich as Chief Product Officer and Vorstand, growing its private 5G business with real-time video applications.
In 2025, BOLDYN Networks UK acquired Smart Mobile Labs AG and Ruediger continues as Chief Operating Officer COO and Vorstand of BOLDYN Network Deutschland AG.
TELEKOM, Microsoft and SONY, Ruediger helped Peer-to-Peer streaming leader Octoshape, Denmark to grow their business in Europe as part of the management team. Octoshape was then acquired by streaming leader Akamai in April 2015.
Thereafter, Ruediger joined Smart Mobile Labs AG in Munich as Chief Product Officer and Vorstand, growing its private 5G business with real-time video applications.
In 2025, BOLDYN Networks UK acquired Smart Mobile Labs AG and Ruediger continues as Chief Operating Officer COO and Vorstand of BOLDYN Network Deutschland AG.
Ruediger holds a Diplom-Informatiker from KIT „Karlsruhe Institut of
Technology“ and a Master in Business Administration from Henley Management College, UK.
Technology“ and a Master in Business Administration from Henley Management College, UK.
Kurzbeschreibung:
Der Vortrag beschreibt die Vorteile von dedizierten 5G-Netzen für bahnspezifische Use Cases und beschreibt die Use Cases aus Anwendersicht. Es werden die Vorteile für den Endnutzer dargestellt sowie die funktionalen Neuerungen, die mit solchen Netzen möglich sind.
Dabei werden Beispiele aus den Erzgebirgsstrecken sowie aus anderen Projekten bei der Deutschen Bahn und anderen dargestellt und diskutiert.
Dabei werden Beispiele aus den Erzgebirgsstrecken sowie aus anderen Projekten bei der Deutschen Bahn und anderen dargestellt und diskutiert.
Zielgruppe:
Bahn-Betreiber, Bahn-Mitarbeiter, Bahn-Forschung, generell Bahn-Interessierte
Vorkenntnisse der Teilnehmenden:
Nein, wünscheswert wären IT-Kenntnisse über Breitbandinternet-Anwendungen
Nein, wünscheswert wären IT-Kenntnisse über Breitbandinternet-Anwendungen
Sprache: EN
A02 - Deutsches Zentrum für Schienenverkehrsforschung
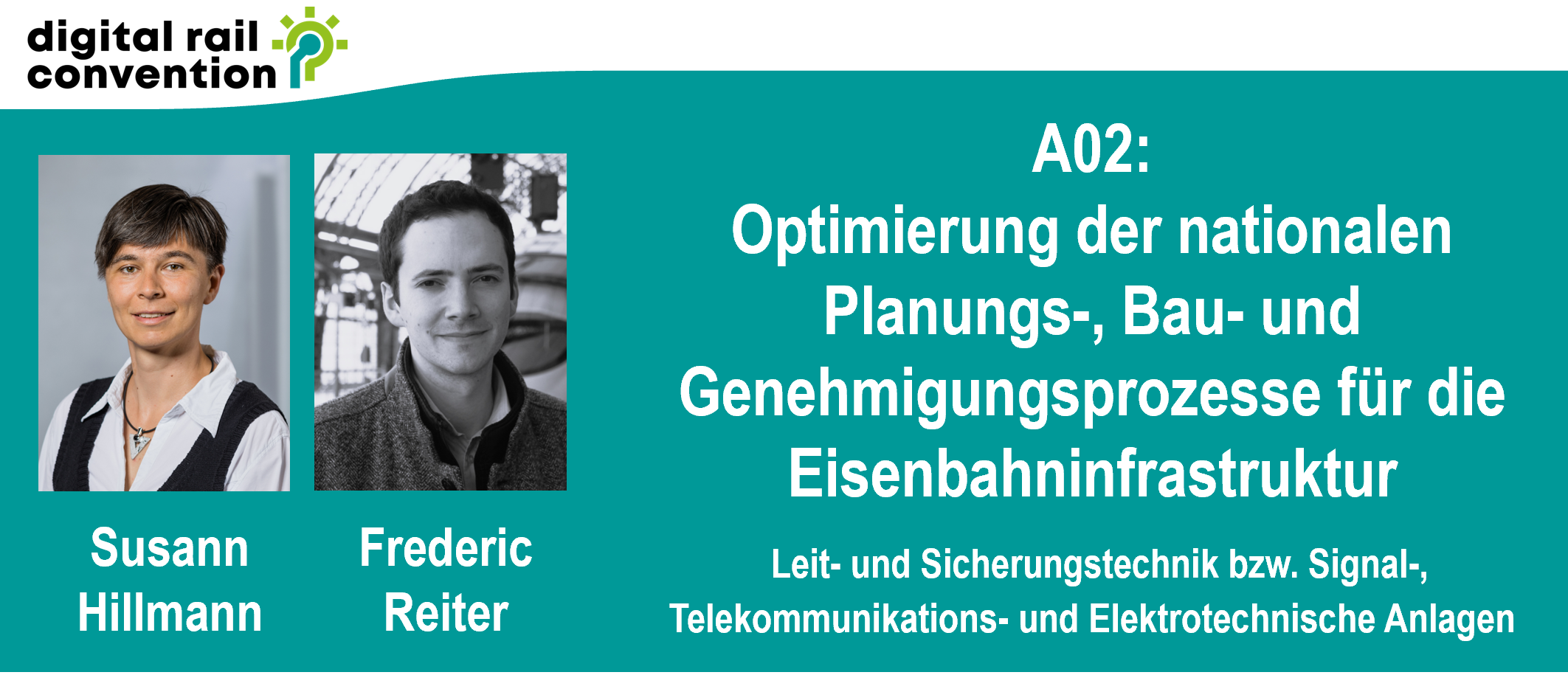
Workstream-Owner:
Susann Hillmann - Deutsches Zentrum für Schienenverkehrsforschung
beim Eisenbahn-Bundesamt
beim Eisenbahn-Bundesamt
Fachbereich 84 - Sicherheit und kritische Infrastruktur, DZSF
Wissenschaftliche Referentin
Aufgaben: Projekte aus den Bereichen Sensorik, Leit- und Sicherungstechnik und Zerstörungsfreie Materialprüfung
Frederic Reiter - Deutsches Zentrum für Schienenverkehrsforschung
beim Eisenbahn-Bundesamt
beim Eisenbahn-Bundesamt
Fachbereich 84 - Sicherheit und kritische Infrastruktur, DZSF
Wissenschaftlicher Referent
Aufgaben: Doktorand zum Thema neue Verifikationsverfahren von LST-Systemen mit formalen Methoden
Kurzbeschreibung:
Die erhöhten Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur werden in den nächsten Jahren zu einem stetig ansteigenden Maßnahmenumfang in allen Lebenszyklus-Phasen der Teilsysteme führen. Gleichzeitig wird der Eisenbahnsektor von dem bereits bestehenden Fachkräftemangel weiter betroffen sein.
Die Planungs-, Bau- und Genehmigungsverfahren sind jedoch komplex und nehmen auch aufgrund fehlender Prüfkapazitäten insgesamt eine lange Zeit in Anspruch. Es besteht der dringende Bedarf, diese Verfahren zu optimieren und zu verschlanken, damit die notwendigen Investitionen fristgerecht umgesetzt und die davon abhängigen Projekte nicht verzögert werden. Der Verkehrsträger Schiene darf in seiner volkswirtschaftlich notwendigen Weiterentwicklung nicht gebremst werden.
Das Ziel des Workstreams ist es, Vorschläge zu sammeln, wie Verbesserungen der aktuellen Prozesse in den Phasen von der Planung über den Bau bis zur Prüfung, Abnahme und Zertifizierung/Genehmigung von Eisenbahnanlagen in den Teilsystemen Infrastruktur, Zugsteuerung, Zugsicherung, Signalisierung und Energieversorgung erreicht werden können.
Es ist geplant, einen kurzen Überblick zu den Genehmigungsprozessen und den daran beteiligten Akteuren sowie speziell zu Projekten des DZSF in dieser Thematik zu geben. Darauf aufbauend sollen Herausforderungen in der Gruppe genannt und diskutiert werden. Abschließend erfolgt eine Sammlung von Verbesserungsideen und deren Bewertung. Die Arbeitsergebnisse sollen in die Projekte des DZSF einfließen und nach wissenschaftlicher Betrachtung in einen Maßnahmenkatalog zur Prozessoptimierung aufgenommen werden.
Die Planungs-, Bau- und Genehmigungsverfahren sind jedoch komplex und nehmen auch aufgrund fehlender Prüfkapazitäten insgesamt eine lange Zeit in Anspruch. Es besteht der dringende Bedarf, diese Verfahren zu optimieren und zu verschlanken, damit die notwendigen Investitionen fristgerecht umgesetzt und die davon abhängigen Projekte nicht verzögert werden. Der Verkehrsträger Schiene darf in seiner volkswirtschaftlich notwendigen Weiterentwicklung nicht gebremst werden.
Das Ziel des Workstreams ist es, Vorschläge zu sammeln, wie Verbesserungen der aktuellen Prozesse in den Phasen von der Planung über den Bau bis zur Prüfung, Abnahme und Zertifizierung/Genehmigung von Eisenbahnanlagen in den Teilsystemen Infrastruktur, Zugsteuerung, Zugsicherung, Signalisierung und Energieversorgung erreicht werden können.
Es ist geplant, einen kurzen Überblick zu den Genehmigungsprozessen und den daran beteiligten Akteuren sowie speziell zu Projekten des DZSF in dieser Thematik zu geben. Darauf aufbauend sollen Herausforderungen in der Gruppe genannt und diskutiert werden. Abschließend erfolgt eine Sammlung von Verbesserungsideen und deren Bewertung. Die Arbeitsergebnisse sollen in die Projekte des DZSF einfließen und nach wissenschaftlicher Betrachtung in einen Maßnahmenkatalog zur Prozessoptimierung aufgenommen werden.
Zielgruppe:
Alle, die mit Prozessen um die Inbetriebnahme von Eisenbahninfrastrukturen zu tun haben:
Mindestens Planer, Prüfer, Ausführende, Bauherren, Behörden, Hersteller.
Mindestens Planer, Prüfer, Ausführende, Bauherren, Behörden, Hersteller.
Vorkenntnisse der Teilnehmenden:
Es sind keine tiefgehenden Kenntnisse notwendig. Erfahrung mit den Prüfungs- und Inbetriebnahmegenehmigungsprozessen der Eisenbahninfrastruktur sind aber sehr willkommen.
Es sind keine tiefgehenden Kenntnisse notwendig. Erfahrung mit den Prüfungs- und Inbetriebnahmegenehmigungsprozessen der Eisenbahninfrastruktur sind aber sehr willkommen.
Sprache: DE
A03 - DB InfraGo AG & dSpace GmbH
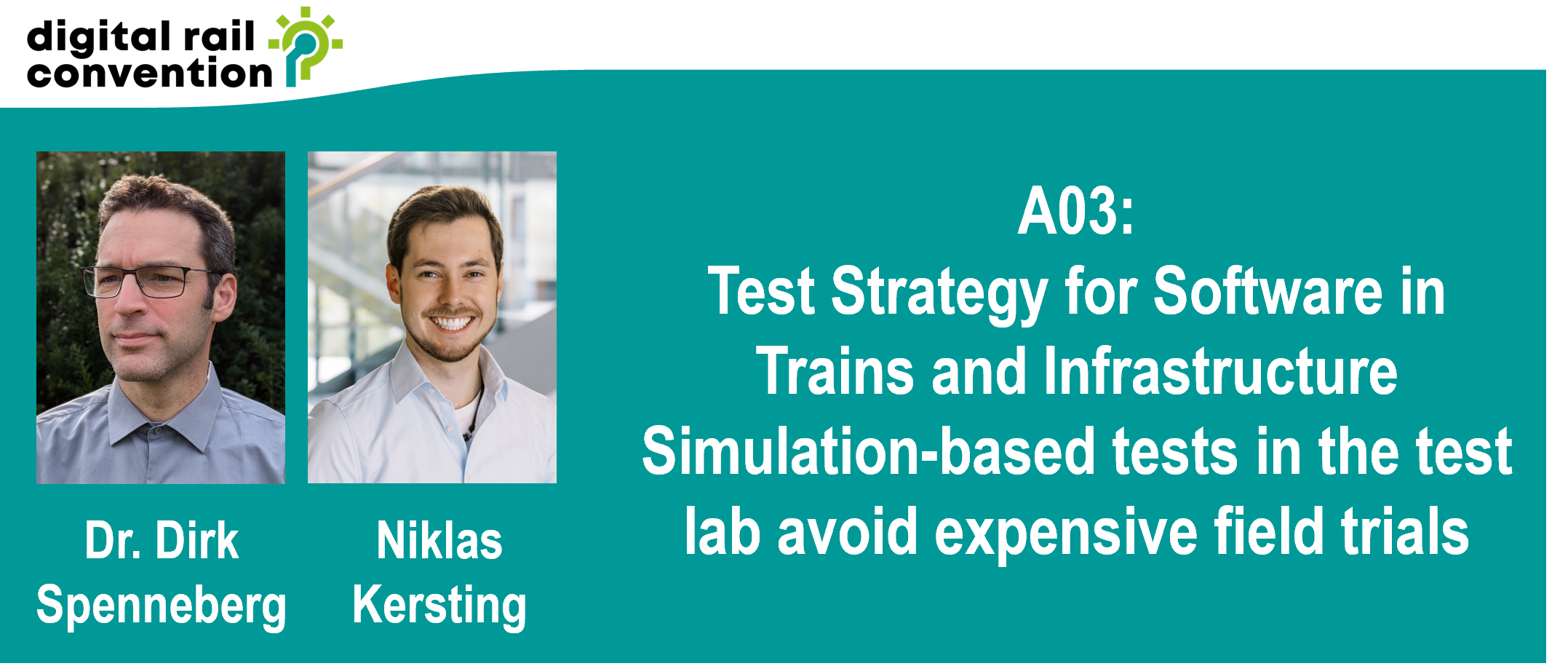
Workstream-Owner:
Dr. Dirk Spenneberg - DB InfraGo AG
LST-Plattform - Systemintegration
Dirk Spenneberg ist langjähriger Experte im Bereich der Systemintegration, -simulation und des -tests und hat dort vielfältige Projekte und Teams geleitet.
Niklas Kersting - dSPACE GmbH
Simulation Models & Scenarios
Er ist Produktmanager für das dSPACE Produkt AURELION. AURELION ist eine Software zur hochrealistische physikbasierte Sensorsimulation. Die mit AURELION generierten synthetischen Sensordaten werden von Kunden zum Testen von autonomen Fahrfunktionen & Fahrassistenzfunktionen verwendet.
Kurzbeschreibung:
The development of modern rail transportation systems, such as new types of digital signalling systems or highly to fully automated, driverless trains, requires numerous tests to prove the reliable and safe functioning of the control system under all possible operating and environmental conditions. New onboard systems take over control of the train instead of a train driver. These systems use powerful sensors for object and environment perception, for example. The increasing complexity of both onboard and trackside systems requires extensive testing. ATO is just one example of the challenges of increasing complexity due to the increasing integration of software and control systems in trains and infrastructure. However, classic field tests are difficult to carry out in the rail sector, as the availability of tracks and trains for testing is limited. Efficient, simulation-based test strategies are a solution to reduce expensive and time-consuming field tests to a minimum.
In the workstream, the opinions and current situation of the participants in relation to the testing of safety-critical systems will be collected and summarized. On the basis of the participants' contributions, the main challenges in testing and validating control systems in trains and infrastructure will be examined in more detail and various aspects of the test approaches will be derived. The simulation-based testing of onboard and trackside systems developed in the “Automated Train” project as part of the Digital Rail Germany (DSD) sector initiative serves as an example.
Furthermore, remaining risks and potential extensions for an effective test strategy will be discussed, taking into account the components to be tested and possible test methods. The aim of the workstream is to provide information on common validation strategies for rail systems, which can serve as a recommendation for action for various players in the rail industry. In addition, an exchange platform is to be offered in order to be able to exchange information about hurdles and potentials in the testing of safety-critical systems.
In the workstream, the opinions and current situation of the participants in relation to the testing of safety-critical systems will be collected and summarized. On the basis of the participants' contributions, the main challenges in testing and validating control systems in trains and infrastructure will be examined in more detail and various aspects of the test approaches will be derived. The simulation-based testing of onboard and trackside systems developed in the “Automated Train” project as part of the Digital Rail Germany (DSD) sector initiative serves as an example.
Furthermore, remaining risks and potential extensions for an effective test strategy will be discussed, taking into account the components to be tested and possible test methods. The aim of the workstream is to provide information on common validation strategies for rail systems, which can serve as a recommendation for action for various players in the rail industry. In addition, an exchange platform is to be offered in order to be able to exchange information about hurdles and potentials in the testing of safety-critical systems.
Experts and decision-makers for testing, simulation, validation
Background knowledge of the participants
Vorkenntnisse der Teilnehmenden:
No prior knowledge is required, but a certain technical background would be advantageous.
Sprache: DE/EN
Entfällt - A04 - Forschungsinitiative REAKT, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
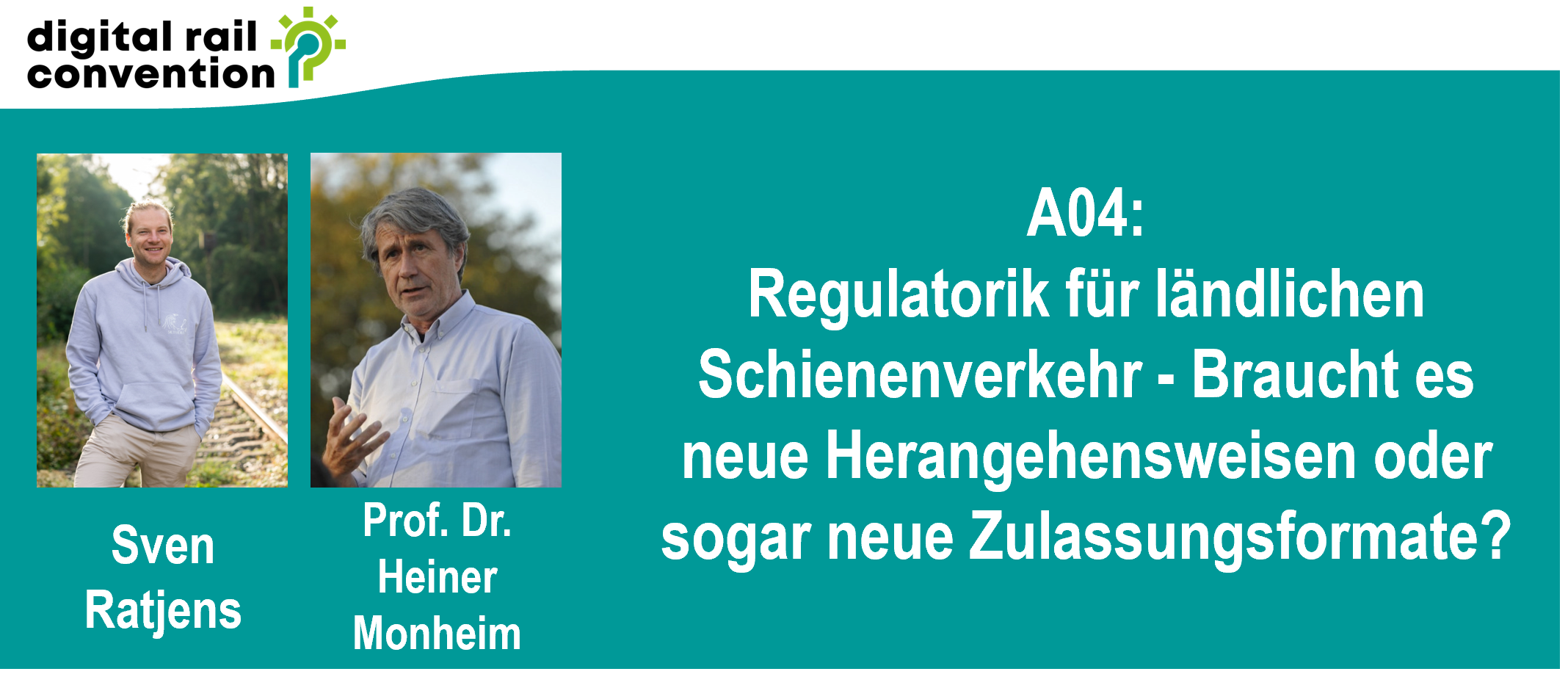
Workstream-Owner:
Sven Ratjens - Christian-Albrechts-Universität zu Kiel / Fachbereich Informatik
Koordination der Forschungsinitiative REAKT
Prof. Dr. Heiner Monheim - Schienenverkehr Malente-Lütjenburg e.V.
Mitglied des strategischen Managements der Forschungsinitiative REAKT
Koordination der Forschungsinitiative REAKT
Prof. Dr. Heiner Monheim - Schienenverkehr Malente-Lütjenburg e.V.
Mitglied des strategischen Managements der Forschungsinitiative REAKT
Kurzbeschreibung:
Um ländlichen Schienenverkehr wirtschaftlich möglich zu machen, bieten technologische Innovationen der Digitalisierung und Automatisierung große Potenziale. Das solche Innovationen dabei helfen können, die Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit von Schienenverkehr zu erhöhen, wird im SRCC innerhalb des klassischen Eisenbahnrechts (EBO) erforscht und vorangetrieben. Ergänzend dazu werden in der Forschungsinitiative REAKT in Schleswig-Holstein auch technologische Ansätze erforscht, welche auch in ganz dünn besiedelten Räumen wirtschaftlichen Schienenverkehr ermöglichen könnten – wobei zumindest einige Komponenten jedoch nach heutiger Auslegung der EBO keine Chance auf Genehmigung hätten. Solche Ansätze, wie es sie auch in Frankreich, Japan und England gibt, denken den Verkehrsträger Schiene neu. Sie umfassen neue Kleinfahrzeuge, welche nach der heutigen Auslegung der Zulassungsverfahren für die EBO nicht zulassungsfähig erscheinen. An allen Forschungsstandorten zum Thema Schienenverkehr stellt sich für innovativen Ansätze der Automatisierung der Schiene in der Praxis häufig nicht die technische Machbarkeit, sondern die Regulatorik als große Hürde heraus. Im Workstream soll herausgearbeitet werden, vor welchen regulatorischen und zulassungsrechtlichen Problemen die Akteure an den unterschiedlichen Forschungsstandorten stehen, welche Erfahrungen im Umgang mit den Zulassungsbehörden gemacht werden und inwieweit die Zulassungsverfahren angepasst werden müssten, um Innovationen (schneller) genehmigungsfähig und somit in die Anwendung zu bekommen. Zudem soll die Fragen diskutiert werden, ob die EBO innovationsoffen genug ist, ob es eine Novellierung der EBO braucht oder ob es – neben EBO und BOSTrab – evtl. neue regulatorisches Formate für ländlichen Schienenverkehr braucht. Als Ergebnis könnte eine standortübergreifend abgestimmte Kooperation in der Kommunikation mit den Gesetzgebern zu diesen Fragestellungen stehen.
Akteure (Hochschulen und Unternehmen) aus Forschungsprojekten im Bahnbereich
Vorkenntnisse der Teilnehmenden:
Es sind keine umfangreichen Grundkenntnisse zwingend erforderlich. Grundkenntnisse des Eisenbahnrechts wären hilfreich. Erfahrungswerte aus abgeschlossenen oder laufenden Forschungsprojekten wären sehr wertvoll, sind aber kein „Muss“.
Sprache: DE
A05 - DB InfraGO AG
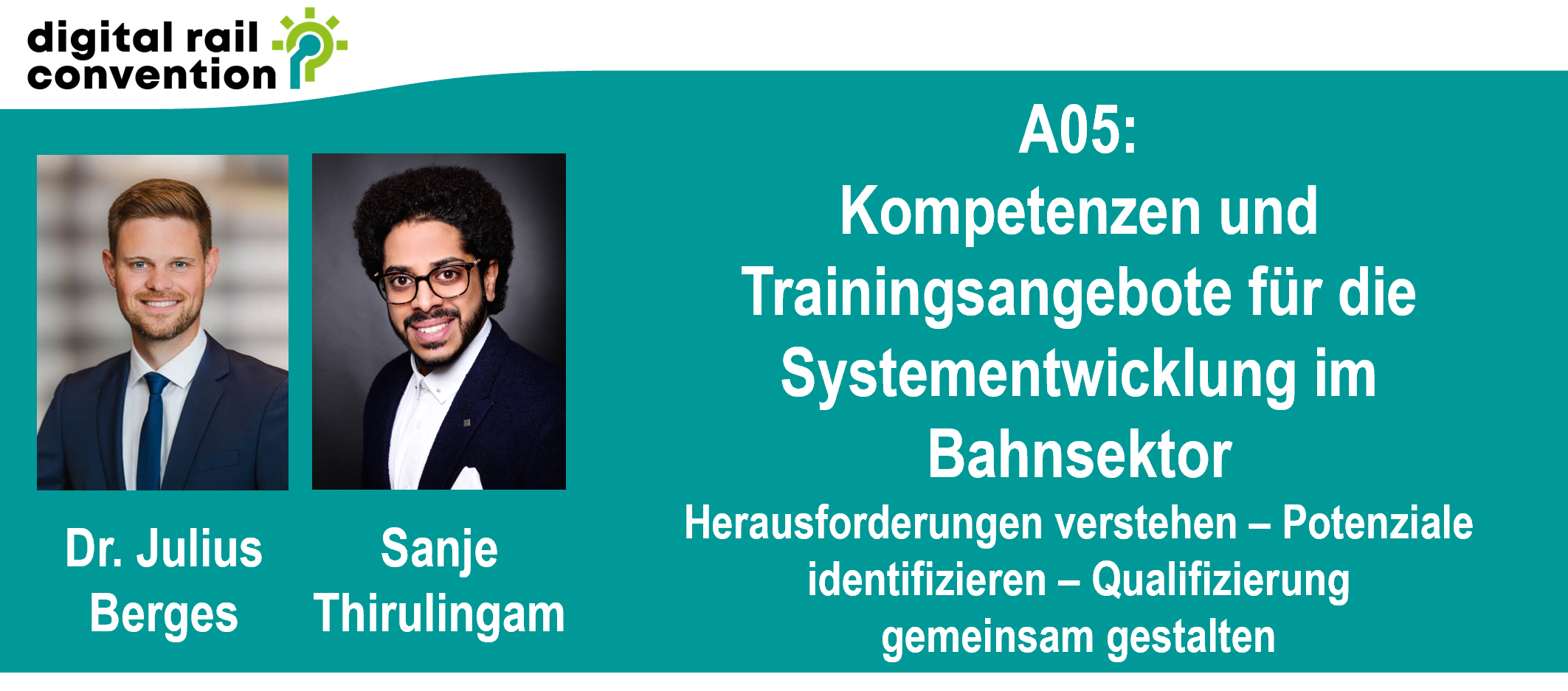
Workstream-Owner:
Dr. Julius Berges - DB InfraGO AG
Seniorreferent Fachliche Qualifizierung - Digitale Technologien, I.IAI 153
Produktverantwortlicher Systems Engineering
Produktverantwortlicher Systems Engineering
Sanje Thirulingam - DB InfraGO AG
Seniorreferent Fachliche Qualifizierung - Digitale Technologien, I.IAI 153
Produktverantwortlicher Telekommunikation
Seniorreferent Fachliche Qualifizierung - Digitale Technologien, I.IAI 153
Produktverantwortlicher Telekommunikation
Kurzbeschreibung:
Wir geben einen Einblick in unsere Arbeit zur fachlichen Qualifizierung bei der DB InfraGO AG und fokussieren uns auf den Lebenszyklusabschnitt „Entwicklung“. Denn angesichts zunehmend digitalisierter und komplexer Systeme im Bahnsektor rückt die Systementwicklung stärker in den Fokus – und damit auch der Bedarf an entsprechenden Seminaren und Trainings. Gemeinsam mit den Teilnehmenden wollen wir aktuelle Herausforderungen sichtbar machen und Qualifizierungsbedarfe ableiten. Ziel ist es, fachliche Fokusthemen und Kompetenzlücken zu identifizieren, um zielgerichtete Angebote bereitzustellen:- Wo liegen derzeit die größten fachlichen Herausforderungen in der Systementwicklung im Bahnsektor?
- Welche Aufgaben sind aus Ihrer Sicht besonders aussichtsreich für Ansätze der (modellbasierten) Systementwicklung?
- Wo in der Systementwicklung besteht besonders Bedarf an Trainings und Seminaren – und auf welchem Kompetenzniveau
Jede Person, die Interesse an einem Austausch zu den Herausforderungen der Systementwicklung und Trainings in diesem Bereich hat, ist willkommen.
Vorkenntnisse der Teilnehmenden:
Es ist kein spezifisches Vorwissen notwendig. Explizit freuen wir uns über Teilnehmende, die aus vielen Bereichen Ihre Erfahrungen in der Entwicklung einbringen können
Sprache: DE/EN
A06 - Neovendi GmbH

Workstream-Owner:
Dr. Kerstin Keil - Neovendi GmbH
Dr. Kerstin Keil arbeitet seit 2020 bei der Neovendi GmbH als Senior Project and Digital Transformation Manager. Sie war viele Jahre Teil von Telekommunikations- und IT Projekten, sowohl im Bereich F&E als auch Consulting. Seit 2023 leitet sie das vom BMV geförderte Projekt Minos.
Dr. Delf Kah - DB Systel GmbH
Einheit Solutions for Rail Operations
Dr. Delf Kah arbeitet seit 2023 bei der DB Systel GmbH als Business Analyst. Als Mitglied der Einheit Solutions for Rail Operations ist er in verschiedenen Projekten daran beteiligt, die Prozesse des Konzernpartners DB InfraGO zu digitalisieren. Beim Projekt MINOS ist er Teilprojektleiter der DB Systel.
Kurzbeschreibung:
Das mFUND Projekt MINOS stellt zunächst die generelle Bedeutung aktueller und zuverlässiger Bahndaten für verschiedene Nutzergruppen (Feuerwehren, Teilnehmer am Straßenverkehr, bahninterne Nutzer) dar. Danach werden eigene Forschungsergebnisse zur Schließprognose von Bahnübergängen vorgestellt.
Zielgruppe:
Studierende im Verkehrsbereich (Bahn, Straße), Verkehrsplaner, Rettungsdienste/Freiwillige Feuerwehren, Systemhersteller Navigationssysteme Straßenverkehr, Systemhersteller Bahnübergänge
Vorkenntnisse der Teilnehmenden:
Grundverständnis System Bahn und für Routenplanung sind wünschenswert
A07 - TU Berlin
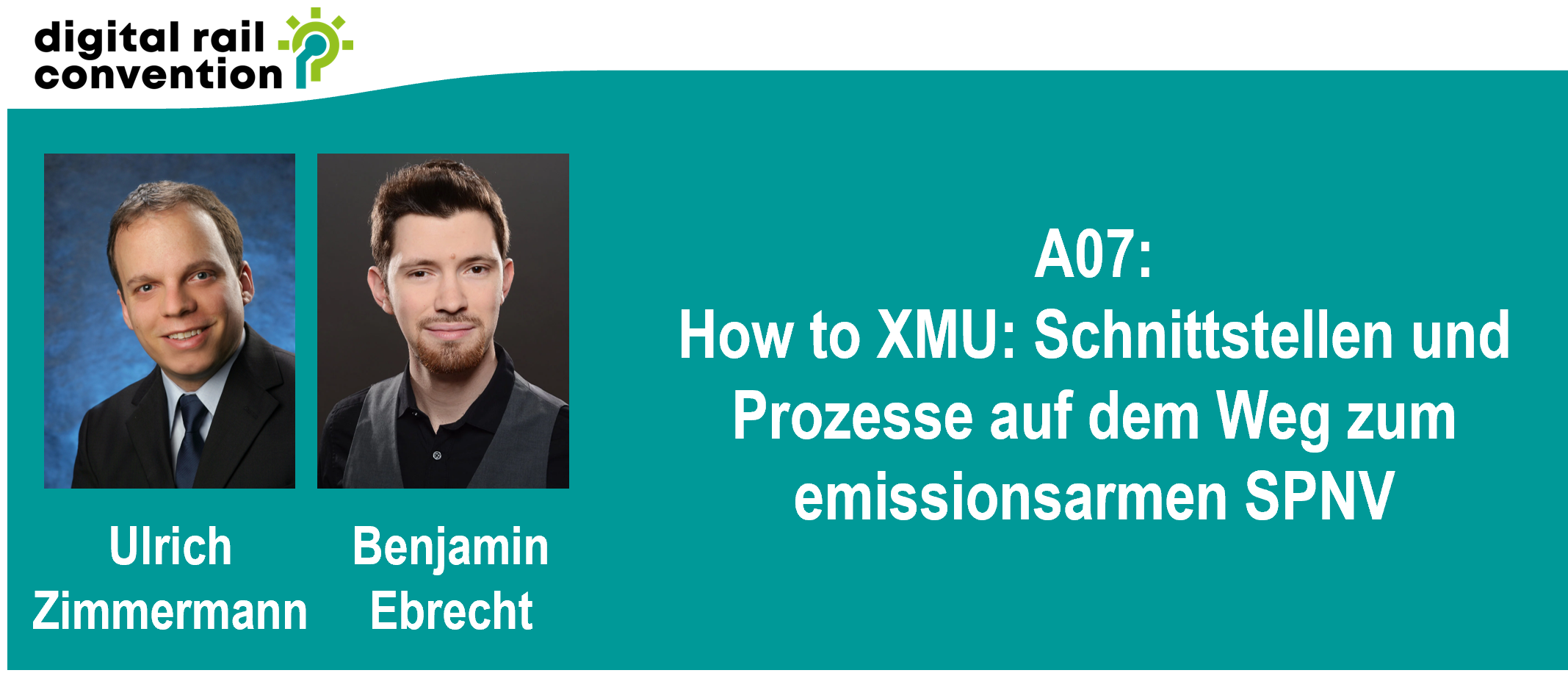
Workstream-Owner:
Ulrich Zimmermann - TU Berlin
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet Bahnbetrieb
Forschungsschwerpunkt:
Gesamtsystem alternative Antriebe, Batterie- und Wasserstofffahrzeuge, betriebliche Integration, Struktur- und Anreizsysteme.
Benjamin Ebrecht - TU Berlin
Benjamin Ebrecht - TU Berlin
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet Bahnbetrieb
Forschungsschwerpunkt: alternative Antriebe, dabei Bearbeitung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten sowie Machbarkeitsstudien mit Fokus auf bahnbetrieblichen Konzepten, Simulations- und Messdurchführungen und praxisnahe Projektbegleitung
Kurzbeschreibung:
Alternative Antriebssysteme im Schienenverkehr kommen in Deutschland aktuell hauptsächlich in Form von Batterie- bzw. Wasserstofftriebzügen (BEMU/HEMU) zum Einsatz. Aufgrund der technologischen Eigenschaften ist eine starke Verknüpfung von Fahrzeug, Betrieb und Infrastruktur notwendig, insbesondere im Hinblick auf Reichweite und Aufladung/Betankung.Für die jeweiligen Ausschreibungsnetze / Einsatzszenarien werden – meist getrieben von den SPNV-Aufgabenträgern – maßgeschneiderte Lösungen angestrebt. Diese enthalten viele Abwägungsfälle, durch welche Stellschrauben eine Reichweitenfrage beantwortet werden kann: Wird eine größere Traktionsbatterie benötigt, ist alternativ eine längere Wendezeit zur Aufladung möglich oder ist es zielführend, das Problem durch eine Erweiterung der Ladeinfrastruktur zu lösen?Dies alles bedingt das Zusammenspiel vieler Akteure, die ihrerseits spezifische Aufgaben, einen bestimmten Gestaltungsspielraum und Interessen, nicht zuletzt beim Thema Finanzierung haben. Zu nennen sind hier die SPNV-Aufgabenträger mit Ihren dahinterstehenden Bundesländern, Fahrzeug- und Infrastrukturhersteller sowie die Betreiber der Infrastruktur und die Verkehrsunternehmen. Es stellen sich neue regulatorische Fragen, die beispielsweise eine Einbindung der Bundesnetzagentur erfordern, beispielsweise im Hinblick auf Ladeinfrastruktur. Dieses Zusammenwirken kann teilweise auf etablierten Strukturen aufbauen, teilweise ergaben und ergeben sich auch weiterhin neue Beziehungen.
Ziel des Workstreams ist die Erstellung einer Übersicht über die grundsätzlichen Strukturen der Organisation von alternativen Antrieben im Schienenverkehr. Dabei sollen alle Akteure und ihre jeweiligen Aufgaben und Rahmenbedingungen unter Berücksichtigung der Schnittstellen gegliedert werden. Zusätzlich ist die Erarbeitung einer Zeitschiene geplant, um die unterschiedlichen Planungsvorläufe der einzelnen Teilbereiche in der Gesamtplanung besser aufeinander abstimmen zu können und kritische Pfade zu identifizieren. So werden Behinderungen vermieden, die entstehen können, wenn beispielsweise die Fahrzeuge zur Verfügung stehen, aber die Errichtung von Ladeinfrastruktur noch nicht abgeschlossen ist. Auch Mitigationsstrategien sollen hier mit aufgenommen werden.
Sprache: DE
A08 - Deutsches Zentrum für Schienenverkehrsforschung
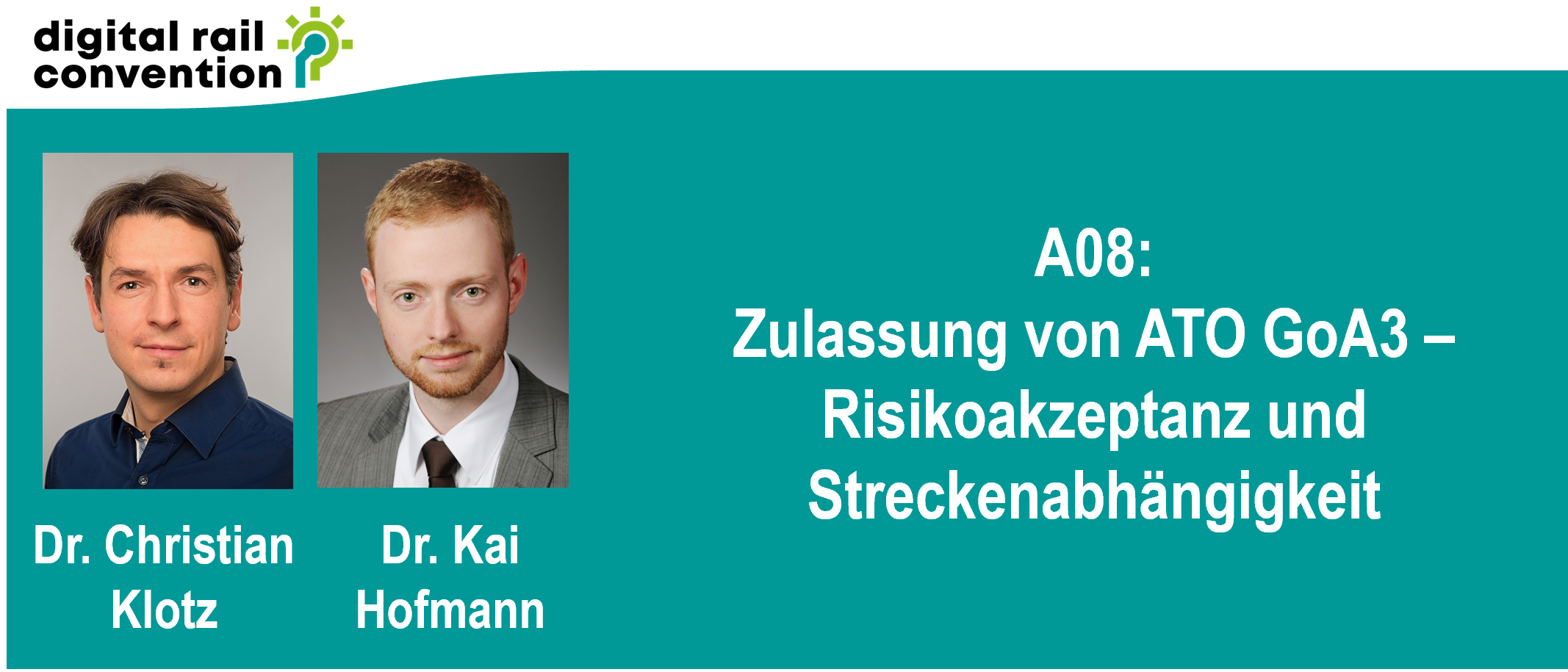
Workstream-Owner:
Dr. Christian Klotz - Deutsches Zentrum für Schienenverkehrsforschung
beim Eisenbahn-Bundesamt
Fachbereich Digitalisierung und Technik
Fachbereich Digitalisierung und Technik
Wissenschaftlicher Referent Automatisierung
Technische Fragen und Sicherheit bei automatisierten Fahren in den höheren Automatisierungsgraden GoA 3 und 4
Technische Fragen und Sicherheit bei automatisierten Fahren in den höheren Automatisierungsgraden GoA 3 und 4
Dr. Kai Hofmann - Deutsches Zentrum für Schienenverkehrsforschung
beim Eisenbahn-Bundesamt
Fachbereich Digitalisierung und Technik
beim Eisenbahn-Bundesamt
Fachbereich Digitalisierung und Technik
Wissenschaftlicher Referent Recht
Beschäftigt sich u .A. mit rechtlichen Fragestellungen im Bereich innovativer Lösungen im Bahnsystem, z.B. ATO, PM
Beschäftigt sich u .A. mit rechtlichen Fragestellungen im Bereich innovativer Lösungen im Bahnsystem, z.B. ATO, PM
Kurzbeschreibung:
Beim automatisierten Fahren in GoA3 oder GoA4 werden sicherheitsrelevante Aufgaben des Triebfahrzeugführers durch die Technik übernommen. Insbesondere die Überwachung des Fahrwegs und dessen Umgebung auf Hindernisse, Schäden und Gefahren stellt dabei eine große Herausforderung dar. Aktuell wird versucht, diese Aufgabe mittels Multi-Sensor-Systemen zu lösen, wobei für die Auswertung der Sensordaten teils KI-basierte Systeme eingesetzt werden. Der Nachweis ausreichender Sicherheit ist bei diesen Systemen eine Herausforderung, einerseits aufgrund der offenen Einsatzumgebung, andererseits hinsichtlich der Verlässlichkeit der ggf. verwendeten KI-Komponenten. Dreh- und Angelpunkt für die Zulassung und den Betrieb von ATO GoA3 und GoA4 ist das Risikomanagementverfahren der CSM RA, bestehend aus Systemdefinition und Risikobewertung (Risikoanalyse und Risikoevaluation). Das DZSF verfolgt in der Risikobewertung den Ansatz des szenarienbasierten Testens, wie er auch im neuen Rechtsrahmen für die Zulassung von autonomen Kfz (SaE4) vorgeschrieben wird. In diesem Kontext laufen am DZSF aktuell die Projekte ATO Szenarien und ATO Performance. Wir werden die (Zwischen-)Ergebnisse der Projekte präsentieren und mit den Teilnehmern folgende Fragen diskutieren:
- Szenarienauswahl: Welche Szenarien sollten zum Mindestset der Zulassung gehören? Welche könnten den Herstellern als optional überlassen werden?
- Risikoakzeptanz I: Muss ein System in den Tests für jedes Szenario ein vorgegebenes Sicherheitsniveau erreichen (so wie im Kfz-Bereich) oder wie können einzelne Szenarien ausgeglichen werden, wenn das Gesamtsicherheitsniveau akzeptabel ist? Dies kann z.B. auch verschiedene Unterszenarien betreffen, wie beispielsweise das Erkennen desselben Objekts unter verschiedenen Bedingungen.
- Risikoakzeptanz II: Entwicklung und Herstellung sowie Betrieb des Fahrzeugs und die Infrastruktur liegen oft in unterschiedlichen Händen. Ebenso ist die Verantwortung für die Sicherheit aufgeteilt. Es wird voraussichtlich kein Universal-ATO-Fahrzeug geben, das mit allen Betriebsweisen und Infrastrukturen kompatibel ist. Andererseits ist es wünschenswert, die Entwicklung und den Sicherheitsnachweis nicht für alle Anwendungen wiederholen zu müssen. Daher werden Schnittstellen benötigt, die eine möglichste breite Anwendung erlauben, und die Verantwortung und Aufgaben der einzelnen Akteure gegeneinander abgrenzen.
Wie werden Szenarien wie „Objekt auf Bahnübergang“ oder „Personen im Gleis“ bewertet? Denkbar wäre, diese Szenarien streckenspezifisch je nach Anforderungsrate zu betrachten. Auf Strecken mit einer hohen Wahrscheinlichkeit für z.B. Personen im Gleis müsste das entsprechende Szenario sehr gut beherrscht werden; bei niedrigen Anforderungsraten entsprechend geringer. Alternativ könnte man wie im Fall von Bahnübergängen vorgehen. BÜ müssten für sich betrachtet sicher sein, egal wie viele BÜ auf einer Strecke vorkommen. Das einzelne Element wird hier unspezifisch zur Strecken betrachtet.
Zielgruppe:
Alle, die ATO-Systeme entwickeln erforschen, betreiben wollen oder anderweitig Interesse an deren Zulassung haben
Vorkenntnisse der Teilnehmenden:
Grundkenntnisse zur ATO
A09 - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.
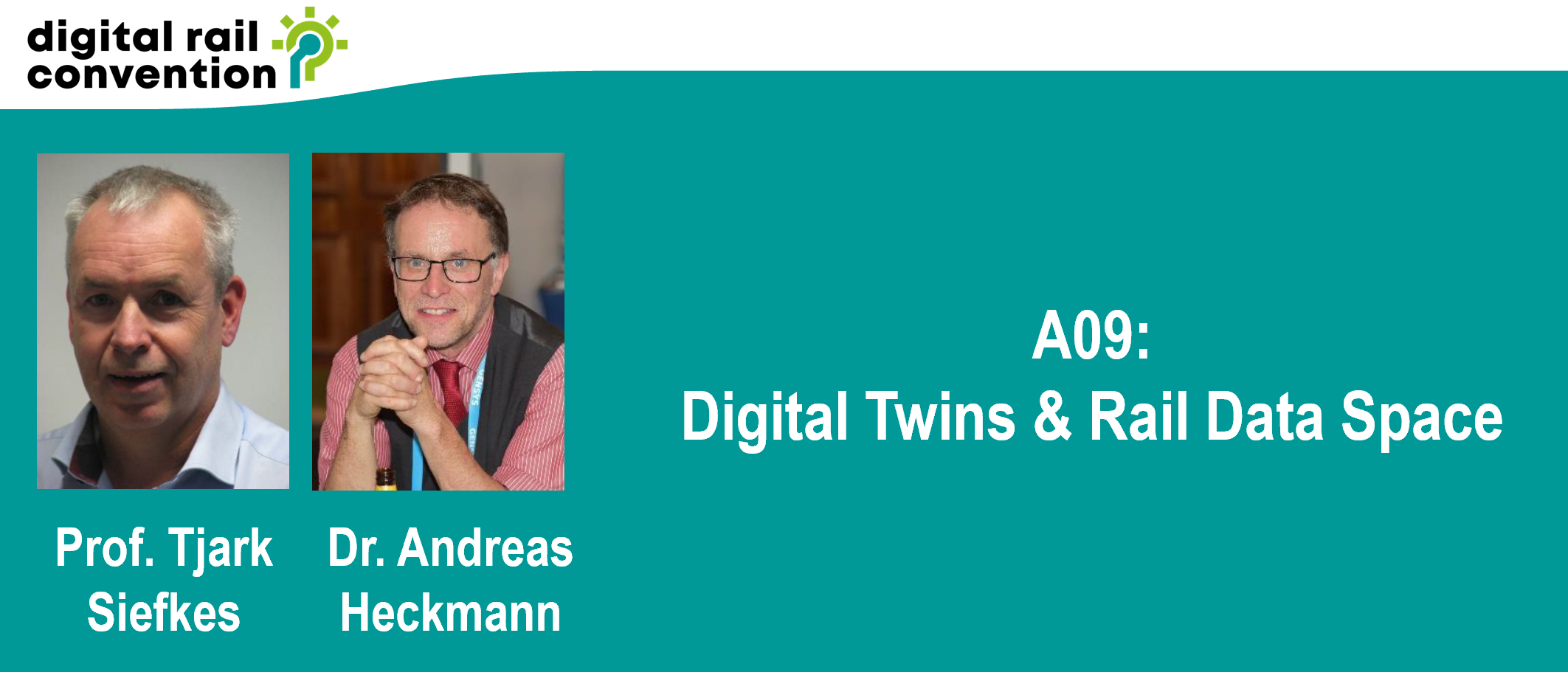
Workstream-Owner:
Prof. Tjark Siefkes - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.
Institut für Fahrzeugkonzepte
Institutsdirektor am DLR Institut für Fahrzeugkonzepte
Programmthemensprecher Schienenverkehr
Tjark Siefkes leitet seit 2020 das Institut für Fahrzeugkonzepte und ist Dozent für Fahrzeugtechnik an der Universität Stuttgart. Er ist langjähriger international anerkannter Forschungs- und Produktmanager in der Fahrzeugbranche; zudem für fünf Jahre erfolgreich als Entwicklungsmanager in der Digitalisierungsbranche tätig. Vertiefte Erfahrungen auf den Gebieten Forschung und Lehre,
Technologie- & Produktentwicklung, Produktmanagement, Marketing, Technikakzeptanz und Wissensmanagement.
Technologie- & Produktentwicklung, Produktmanagement, Marketing, Technikakzeptanz und Wissensmanagement.
Dr. Andreas Heckmann - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.
Institut für Fahrzeugkonzepte
Abteilungsleiter Fahrzeug-Systemdynamik und Regelungstechnik
Andreas Heckmann organisiert seit 2007 das Thema Fahrwerk, Fahrdynamik und Fahrdynamik- Regelung im DLR-Langzeitprojekt Next Generation Train. Er ist Hauptautor mehrerer Modelica- Bibliotheken zur Simulation multiphysikalischer Systeme und leitet seit 2023 das Arbeitspaket Digital Twins im Europe's Rail Projekt MOTIONAL
Johannes Pagenkopf - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.
Institut für Fahrzeugkonzepte
Dr.-Ing. Erik Grunewald - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.
Institut für Verkehrssystemtechnik
Gruppenleiter: Informationsmanagement
Kurzbeschreibung:
Die Digitalisierung des Eisenbahnsektors mithilfe von Konzepten, Technologien und Werkzeugen zur Nutzung von Daten, Diensten und digitalen Infrastrukturen ist ein wichtiger Bereich, der zurzeit im Rahmen der europäischen Partnerschaft für Forschung und Innovation im Schienenverkehr bearbeitet wird, siehe EU-Rail Projects. Vision und Konzepte speziell zu den Themen Digital Twins & Rail Data Space in EU-Rail werden in diesem Workstream zunächst kurz erläutert. In 2 weiteren schlaglichtartigen Vorträgen werden Inhalte vorgestellt, und zwar zu einem die Idee eines Resilienz Katasters Schiene und zum zweiten das Konzept der dynamische Sitzplatzreservierung. Nach dieser Vorbereitung sollen im World Cafe Format weitere Wünsche und Umsetzungsideen auch im Lichte aktueller Entwicklungen z.B. im Bereich Sicherheit durch aktive Einbindung des Teilnehmerkreises gesammelt und diskutiert werden.
Impulsvorträge:
Digitaler Zwilling in EU Rail, Dr. Andreas Heckmann Resilienz Kataster, Johannes Pagenkopf Dynamische Sitzplatzreservierung, Dr.-Ing. Erik Grunewald
Digitaler Zwilling in EU Rail, Dr. Andreas Heckmann Resilienz Kataster, Johannes Pagenkopf Dynamische Sitzplatzreservierung, Dr.-Ing. Erik Grunewald
World-Cafe mit 3 Themen
Sprache: DE- Digitaler Bahn Zwilling, Quo vadis?
- Wie kann Digitalisierung die Security des Bahnverkehrs verbessern?
- Können wir durch dynamische Sitzplatzreservierung überfüllte Bahnsteige vermeiden und Verspätungen reduzieren?
A10 - SWS Digital e. V. und Netzwerkpartner
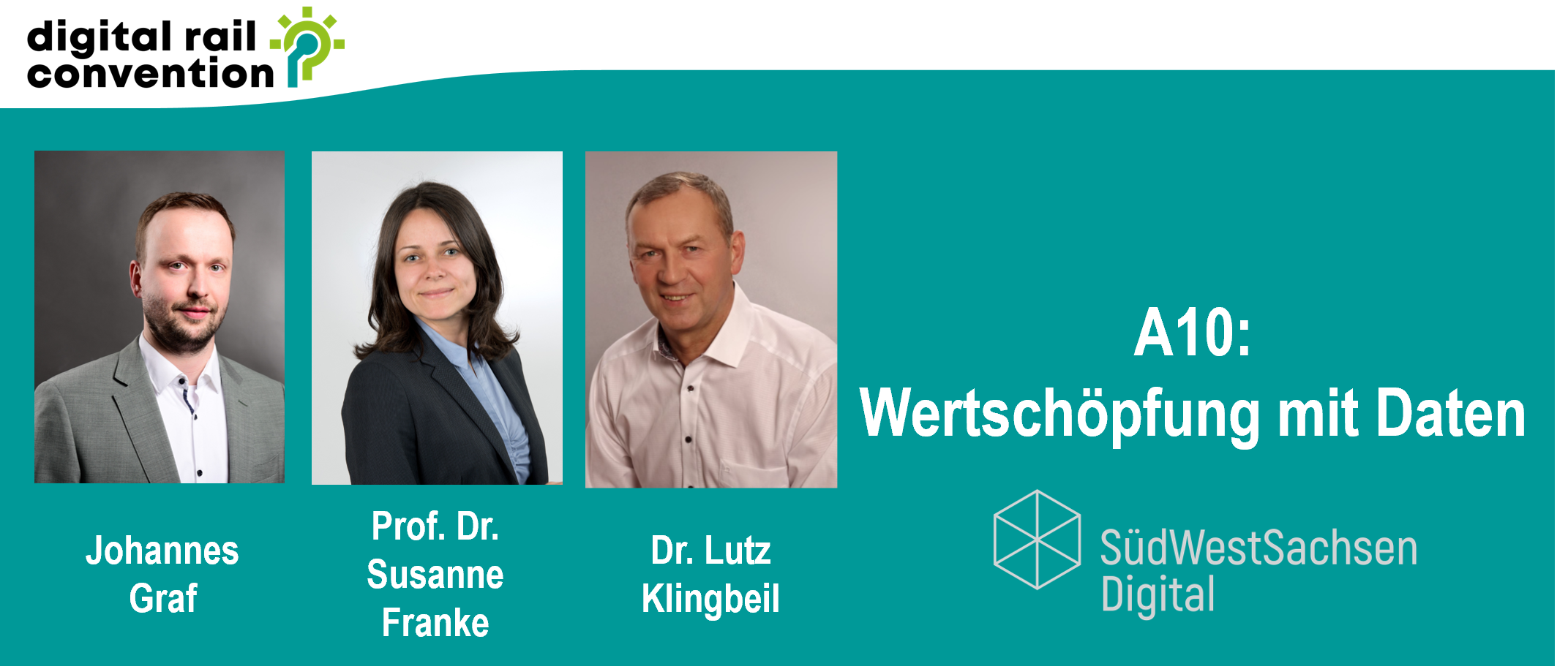
Workstream-Owner:
Netzwerk Südwestsachsen Digital (SWS Digital) e. V.
Referenten:
Johannes Graf - richter & heß VERPACKUNGS-SERVICE GmbH
Geschäftsführer
Prof. Dr. Susanne Franke - Hochschule Mittweida
Dr. Susanne Franke ist eine der Gründer und Geschäftsführer der d-opt GmbH, eines auf Datenanalyse und Künstliche Intelligenz spezialisierten Unternehmens. Mit dem klaren Fokus auf Prozessoptimierung in Produktionsunternehmen und öffentlichen Verwaltungen entwickelt die d-opt GmbH beispielsweise KI-gestützte Lösungen, die aus Daten konkrete Handlungsempfehlungen ableiten. Durch die Kombination von technischer Kompetenz und branchenspezifischem Know-how hilft die d-opt Organisationen dabei, ungenutzte Chancen in ihren Daten zu identifizieren, Arbeitsabläufe gezielt zu optimieren und fundierte Entscheidungen auf Basis aussagekräftiger Analysen zu treffen. Frau Dr. Franke stellt eine Fallstudie vor, die in Zusammenarbeit mit der Dualen Hochschule Plauen entstanden ist.
Seit August 2024 ist Susanne Franke Professorin für Statistik und Data Sciences an der Hochschule Mittweida.
Seit August 2024 ist Susanne Franke Professorin für Statistik und Data Sciences an der Hochschule Mittweida.
Dr. Lutz Klingbeil - ISAP GmbH
Solution Sales Manager
Mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich Solid Edge & PLM
Mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich Solid Edge & PLM
Kurzbeschreibung:
09:45 Uhr: Begrüßung und Vorstellungsrunde
10:20 Uhr: "Energiespitzenlasten reduzieren durch datenbasierte Vorhersage von Verbrauchsmustern. Fallstudie eines produzierenden Unternehmens"
Prof. Dr. Susanne Franke, Hochschule Mittweida
10:40 Uhr: "Smarte Produkte erfordern ein Umdenken bei Produktstrukturen und Prozessen"
Dr. Lutz Klingbeil, ISAP AG
11:00 Uhr: Pause
11:15 Uhr: Diskussion: Erfahrungsaustausch Wertschöpfung mit Daten
Sprache: DEWorkstreams Slot B - Zeit: 13:00 - 15:00
B01 - DB InfraGO AG & TU Chemnitz

Workstream-Owner:
Bernd Holfeld - DB InfraGO AG
Dr. Friederike Maier - DB InfraGO AG
Prof. Dr. Klaus Mößner - Technische Universität Chemnitz, Professur Nachrichtentechnik
Referenten:
Dr. Richard Fritzsche - DB InfraGO AG
Dr. Richard Fritzsche is heading the department Connectivity Platforms at DB InfraGO AG with focus on FRMCS design and evaluation especially in context of ETCS and ATO.
"Hybrid FRMCS networks – technical concepts and international references"
Dr. Christoph Bach - Ericsson GmbH
CTO Service Providers
"The 5G-RACOM Project – Test Infrastructure for 5G Multipath Trials"
Bernd Holfeld - DB InfraGO AG
Teamkoordinator FRMCS Technologieerprobung und Digitales Testfeld Bahn
Ingo Willimowski - Vodafone GmbH
"Multipath setup and testing of use cases"
Dr. Ulrich Geier - Kontron
Kontron Transportation Projektleiter 5G-RACOM, MORANE2
"FRMCS Onboard systems"
Jens Köcher - Funkwerk
Laboratory Supervisor & Test Management at Funkwerk
Laboratory Supervisor & Test Management at Funkwerk
Kurzbeschreibung: Hybrid FRMCS Networks
How can FRMCS networks benefit from public mobile networks?
Compared to GSM-R networks, the architecture of 5G-based FRMCS offers more flexibility for the interconnection between networks. Moreover, FRMCS specifications foresee a multipath function for the realization of seamless end-to-end data transmission in hybrid FRMCS systems.
This workshop will bring together infrastructure managers, railway telecommunication vendors and application service providers as well as participants from railway organizations and agencies, academia and research to discuss the latest work and results in context of hybrid FRMCS networks. The session shall serve as a forum to discuss use cases as well as implementation & validation of technical approaches. Further, it aims to deepen understanding of the advantages and challenges coming from integration of hybrid add-ons. A particular focus will be placed on the 5G-RACOM project, which concludes in 2025. This project explores and demonstrates FRMCS multipath protocols in field trials in DB’s Erzgebirge test track.
FRMCS Experts,
- Railway Infrastructure Managers
- FRMCS Vendors Trackside
- FRMCS Vendors Onboard
- Agencies
Basic FRMCS knowledge
Sprache: EN
B02 - Deutsches Zentrum für Schienenverkehrsforschung
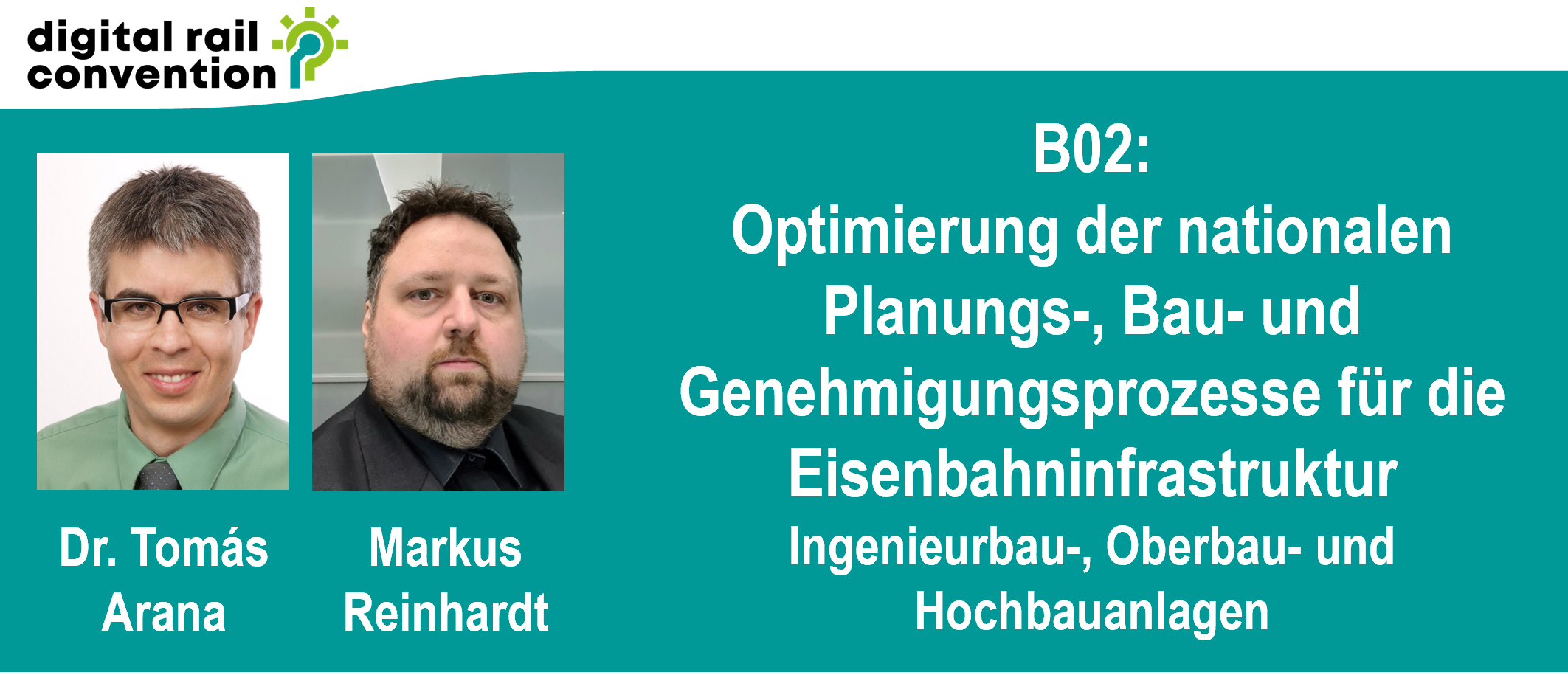
Worksteam-Owner:
Dr.-Ing. Tomás Arana - Deutsches Zentrum für Schienenverkehrsforschung beim Eisenbahn-Bundesamt
Fachbereich 85 - Digitalisierung und Technik, DZSF
Wissenschaftlicher Referent für Ingenieur-, Ober- und Hochbau (IOH)
Wissenschaftlicher Referent für Ingenieur-, Ober- und Hochbau (IOH)
Markus Reinhardt- Deutsches Zentrum für Schienenverkehrsforschung beim Eisenbahn-Bundesamt
Fachbereich 85 - Digitalisierung und Technik
Fachbereichsleitung
Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:
Die erhöhten Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur werden in den nächsten Jahren zu einem stetig ansteigenden Maßnahmenumfang in allen Lebenszyklus-Phasen der Teilsysteme führen. Gleichzeitig wird der Eisenbahnsektor von dem bereits bestehenden Fachkräftemangel weiter betroffen sein.Die Planungs-, Bau- und Genehmigungsverfahren sind jedoch komplex und nehmen auch aufgrund fehlender Prüfkapazitäten insgesamt eine lange Zeit in Anspruch. Es besteht der dringende Bedarf, diese Verfahren zu optimieren und zu verschlanken, damit die notwendigen Investitionen fristgerecht umgesetzt und die davon abhängigen Projekte nicht verzögert werden. Der Verkehrsträger Schiene darf in seiner volkswirtschaftlich notwendigen Weiterentwicklung nicht gebremst werden.
Das Ziel des Workstreams ist es, Vorschläge zu sammeln, wie Verbesserungen der aktuellen Prozesse in den Phasen von der Planung über den Bau bis zur Prüfung, Abnahme und Zertifizierung/Genehmigung von Eisenbahnanlagen in den Teilsystemen Infrastruktur, Zugsteuerung, Zugsicherung, Signalisierung und Energieversorgung erreicht werden können.
Es ist geplant, einen kurzen Überblick zu den Genehmigungsprozessen und den daran beteiligten Akteuren sowie speziell zu Projekten des DZSF in dieser Thematik zu geben. Darauf aufbauend sollen Herausforderungen in der Gruppe genannt und diskutiert werden. Abschließend erfolgt eine Sammlung von Verbesserungsideen und deren Bewertung. Die Arbeitsergebnisse sollen in die Projekte des DZSF einfließen und nach wissenschaftlicher Betrachtung in einen Maßnahmenkatalog zur Prozessoptimierung aufgenommen werden.
Zielgruppe:
Alle, die mit Prozessen um die Inbetriebnahme von Eisenbahninfrastrukturen zu tun haben:
Mindestens Planer, Prüfer, Ausführende, Bauherren, Behörden, Hersteller.
Vorkenntnisse der Teilnehmenden:
Es sind keine tiefgehenden Kenntnisse notwendig. Erfahrung mit den Prüfungs- und Inbetriebnahmegenehmigungsprozessen der Eisenbahninfrastruktur sind aber sehr willkommen.
Sprache: DE
B03 - TU Chemnitz & GNSS Centre of Excellence Novodvorská
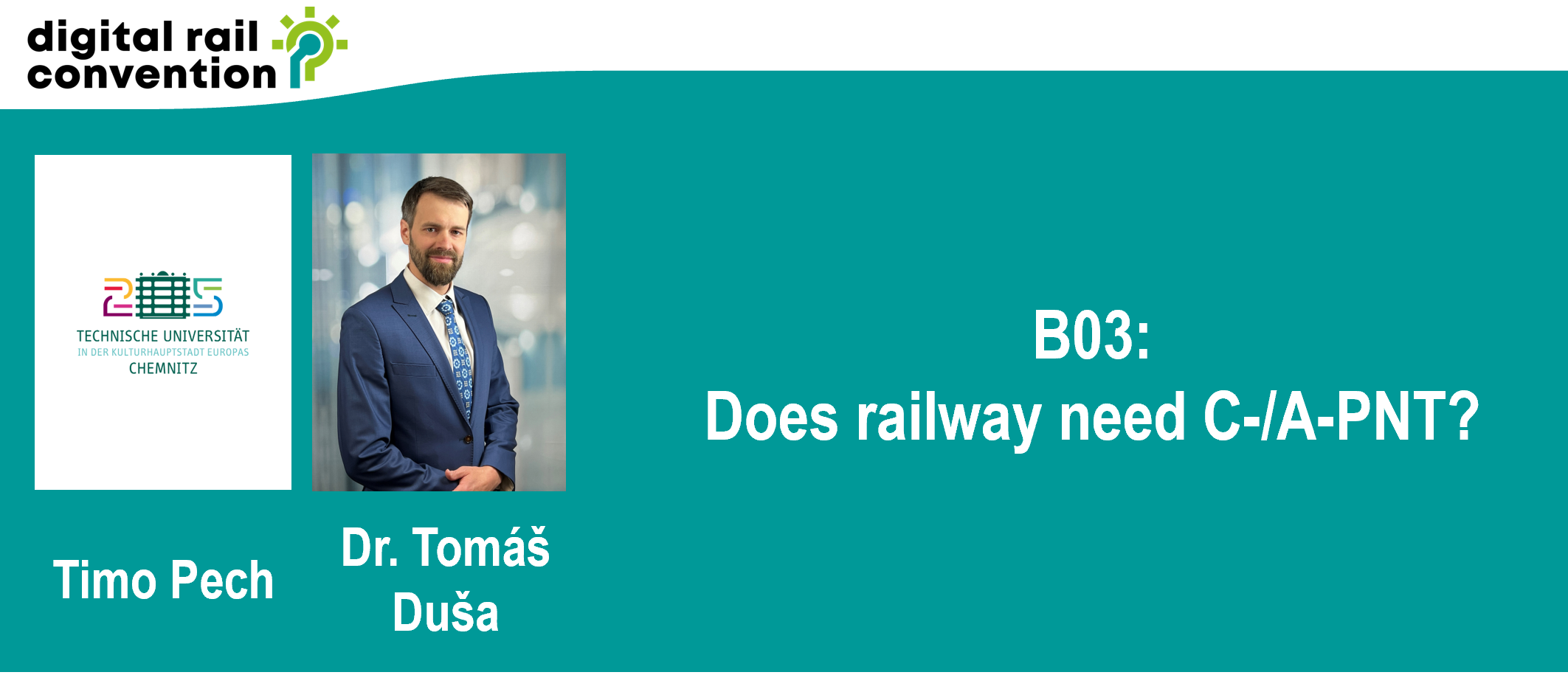
Workstream-Owner:
Timo Pech - Technische Universität Chemnitz Professorship of Communications Engineering
Dr. Tomáš Duša - GNSS Centre of Excellence z.s.p.o.
director
Dr. Tomáš Duša has its background in air traffic management and aviation in general. He is involved in the space technology domain for more than 15 years, focused primarily on GNSS not only in aviation but other transport modes and markets. As Director of the GNSS Centre of Excellence, Tomáš leads activities focused on the integration of GNSS in transport, industry, safety-critical applications and critical infrastructures. As the national expert he is member of various international and EC´s working groups. He also supports space startups within the ESA BIC Czech Republic and provides expert guidance as a Specialist Adviser at CzechInvest – the Czech national agency for innovations and investments.
Kurzbeschreibung:
Track circuits, axle counters, balises provide section occupancy data and reference points for in-track positioning. As key components of the fixed trackside infrastructure, they are widely used for infrastructure-based train localization. Innovative projects such as CLUG, In2Track2, PERFORMINGRAIL are examples of an amount of innovative projects investigating GNSS, IMUs, RFID are exploring GNSS, IMUs, RFID, and other sensors to enhance train localization for various use cases.
The workstream “Does railway need C-/A-PNT?” will address alternative localization approaches in the railway sector using the case study of the project “ALTRAINAV” (Funded by the European Union with tax revenue from the Free State of Saxony and TACR in the Delta2 program). Requirements, possible applications and challenges of alternative and complementary localization techniques will be presented and discussed.
The workstream will include an introduction to the ALTRAINAV project. An overview of localization methods as well as current and future use cases as a starting point for group work. During the group discussion requirements, needs, challenges and further use cases will be collected and evaluated.
Zielgruppe:
railway industry, scientific institutions
Vorkenntnisse der Teilnehmenden:
recommended but not necessary: - European Train Control System
- ATO
- GNSS
- A-PNT / C-PNT
B04 - Hörmann Vehicle Engineering GmbH & CVAG AG

Worksream-Owner:
Florian Joch - Hörmann Vehicle Engineering GmbH
Abteilung DE-S (Softwareentwicklung)
Position/Aufgaben:
- Tätigkeiten in allen Stufen des Softwareentwicklungsprozesses
- Projektierung und Konzeptentwicklung von komplexen (Fahrzeug-)Steuerungen bzw. Steuerungsgeräten
- Umsetzung und Nachverfolgung von Projektmanagementaufgaben für übertragene Projekte bzw. Teilprojekte in komplexen (Fahrzeug-)Entwicklungsprojekten
Technischer Service; Projektingenieur Werkstatt Schienenfahrzeuge
Position/Aufgaben:
- Projektumsetzung / Projektbetreuung (u.a. SmarTram)
- Ersatzteilbeschaffung, Obsoleszenz
Kurzbeschreibung:
Die Herausforderungen zur Einbindung des autonomen/automatisierten Schienenverkehrs in den Betriebskontext sind Inhalt dieses Workstreams. Hierbei soll auf die Abbildung der Fahreraufgaben durch Automatisierung und zukünftige Betriebsaufgaben für das Fahrpersonal (z.B. Umgang mit Notfallsituationen) eingegangen werden. Weiterhin soll diskutiert werden, wie Erfahrungswerte (Fahrverhalten, Umfeldbeobachtung) von Fahrern/Triebfahrzeugführern einfließen können bzw. müssen. Ein wichtiger Punkt ist die Diskussion der Anforderungen an die zukünftige Normung zur Definition des autonomen/automatisierten Fahrens von Straßenbahnen.
Welche Erwartungshaltungen, insbesondere der Betreiber, bestehen an einen Betrieb von automatisierten/autonomen Fahrzeugen? Gibt es Bestrebungen die Infrastruktur im Stadt- und Straßenbahnbereich für einen automatisierten/autonomen Betrieb vorzubereiten? Was ist aus Sicht der Betreiber und der Entwickler dazu nötig?
Der Workstream beginnt mit einer Vorstellung der Herausforderungen des Betriebskontexts im Projekt SmarTram (Straßenbahn). Anschließend folgt der Dialog über die oben genannten Fragestellungen, welcher mit der Erarbeitung von Lösungsansätzen abgeschlossen wird.
Zielgruppe:
Hersteller, Entwickler und Forschende im Bereich automatisiertes Fahren, Fahrzeugbetreiber
Kenntnisse über den Betriebsablauf und die Aufgaben des Fahrpersonals im Schienenverkehr, insbesondere im Straßenbahnbereich, sind wünschenswert.
Sprache: DE
B05 - Siemens Mobility GmbH

Workstream-Owner:
Maik Roggisch - Siemens Mobility GmbH
Jonas Bertram - Siemens Mobility GmbH
Tim Vogelsang - Siemens Mobility GmbH
Kurzbeschreibung:
In den letzten Jahren hat sich neben der Technologie der Leit- und Sicherungstechnik auch die Planung von Anlagen verändert. Die Digitalisierung hat Einzug in die Planung gehalten und somit haben sich auch Prozesse im Vorfeld aber auch bei der Projektrealisierung geändert. Moderne Technologien habe die Planung von Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik nicht nur einfacher, sondern auch effektiver und optimierter gestaltet.
Problemstellung:
Zielstellung des Workstream: Problemstellung:
- Planung ist ein Glied in der Kette bei der Umsetzung von Projekten und somit Kernstück für einen reibungslosen Projektablauf
- Nicht alle Prozesse im Vorfeld der Planung und dann auch bei Realisierung sind digitalisiert – Wo gibt es weitere Potentiale zur Optimierung
- Die Techniken werden komplexer und somit wird auch die Planung umfangreicher (z.B. Netzwerktechniken, Funktechnologien usw.) was auch in der digitalen Planung beachtet werden muss
- Die Anforderungen an die Projekte und deren Planung werden vom Umfang größer (Hochleistungskorridore) und das kann nur mit modernsten digitalen Werkzeugen bewältigt werden
- In Projekt kommt es aber neben dem Termindruck und dem Technologiewandel zu immer neuen Projektbeteiligten, die nur über standardisierte Schnittstellen im Vorfeld von Planungsprozessen mitwirken und die dann aber auch in der digitalen Planung eingebunden werden müssen
- Darstellung des derzeitigen Technologiestandes bei der digitalen Planung und Darstellung der Abhängigkeiten in den Projektprozessen
- Gemeinsame Diskussion über neue Chancen der Digitalisierung in Planungsprozessen und bei der Vorbereitung von Projekten und deren Realisierung
- Erarbeitung von Ideen und Vorschlägen für weitere Schritte in der Digitalisierung von Planung und Realisierung
Ablauf:
- Impulsvortrag (15 Minuten), Einführung in das Thema – Schwerpunkt: Was kann heute die digitale Planung schon leisten und wo gibt es Potentiale?
- Thesen (abgeleitet aus bisherigen Erfahrungen und Anforderungen des Marktes)
- Diskussion
- Abschluss und Zusammenfassung mit Ausblick
Planungsbüros, Eisenbahninfrastrukturbetreiber, Studenten, Technische Experten Eisenbahninfrastruktur, Industrievertreter, wissenschaftliche Mitarbeiter aus dem Bahncluster
B06 - TU Chemnitz - Deutsches Zentrum Mobilität der Zukunft
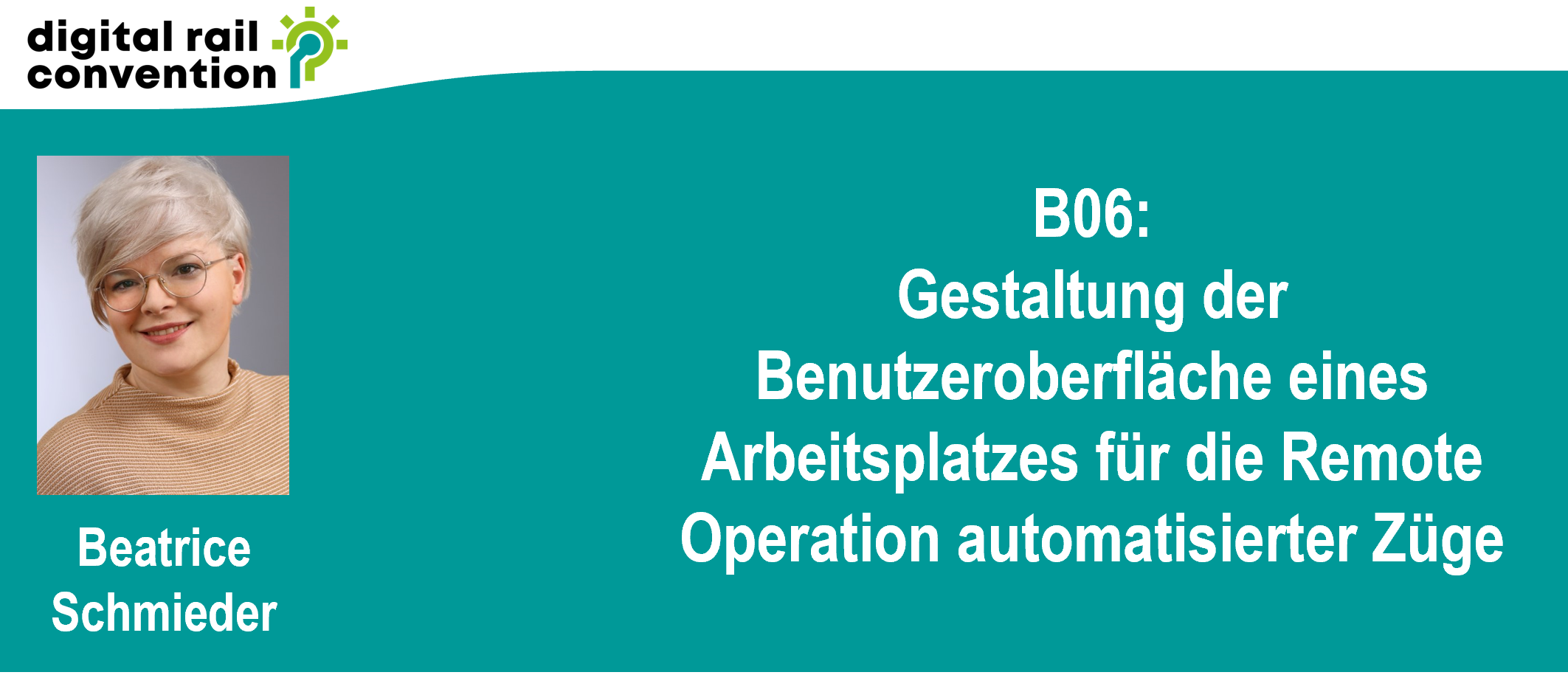
Workstream-Owner:
Beatrice Schmieder - TU Chemnitz, Professur für Allgemeine Psychologe und Human Factors
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Position/Aufgaben: Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin im Projekt „Automatisierung und Digitalisierung bahnbetrieblicher Funktionen“ mit dem Ziel, einen prototypischen Teleoperationsarbeitsplatzes für die Steuerung und Überwachung von automatisierten Zügen zu entwickeln und zu evaluieren.
Kurzbeschreibung: Gestaltung der Benutzeroberfläche eines Arbeitsplatzes für die Remote Operation automatisierter Züge:
Digitalisierung einer Rangierfahrt vom Depot zum Bahnhofsgleis
Digitalisierung einer Rangierfahrt vom Depot zum Bahnhofsgleis
Teleoperierte Zugsysteme dienen als Rückfallebene für hochautomatisierte Züge und als Überwachungssteuerung. Als innovative Lösung können Sie zur Linderung des Fachkräftemangels beitragen und treiben die Automatisierung des Bahnverkehrs voran. Im Projekt AuDiBaF (Automatisierung und Digitalisierung bahnbetrieblicher Funktionen) wird eine prototypische Benutzeroberfläche für einen Arbeitsplatz zur Teleoperation automatisierter Züge interdisziplinär entwickelt und evaluiert. Im Fokus steht hierbei eine ferngesteuerte Rangierfahrt vom Depot zum Bahngleis. In diesem Szenario teilt sich der Remote Operator Aufgaben mit dem automatisierten Zugsystem über eine direkte 5G-Datenverbindung und dient im Störfall als Rückfallebene.
Ziel des Workshops ist die menschzentrierte Weiterentwicklung der bereits bestehenden prototypischen Benutzeroberfläche für den Remote Operator. Dabei werden unterschiedliche Zielgruppen mit einbezogen und die Ergebnisse der Workshops über die Zielgruppen hinweg aggregiert.
Ziel des Workshops ist die menschzentrierte Weiterentwicklung der bereits bestehenden prototypischen Benutzeroberfläche für den Remote Operator. Dabei werden unterschiedliche Zielgruppen mit einbezogen und die Ergebnisse der Workshops über die Zielgruppen hinweg aggregiert.
Die Teilnehmenden erhalten zunächst eine kurze Einführung (30 Minuten) in das Themenfeld, den menschzentrierten Entwicklungs-Prozess nach DIN EN ISO 9241-210:2019 und den Stand der bisherigen Entwicklung des prototypischen Arbeitsplatzes. Die grundlegende Funktionsweise der Bedienoberfläche wird vorgestellt, um anschließend ausgewählte Darstellungsweisen und Interaktionsketten mithilfe von unterschiedlichen Usability-Methoden zu analysieren und weiterzuentwickeln.
Die Teilnehmer werden dafür in zwei Gruppen geteilt. Die gewonnenen Daten werden in anonymisierter Form gespeichert und in der weiteren Entwicklung berücksichtigt. Die Zusammenfassung der Ergebnisse wird den Teilnehmenden auf Wunsch zur Verfügung gestellt. Mit den Erkenntnissen dieser und weiterer Workshops mit unterschiedlichen Zielgruppen wird der prototypische Arbeitsplatz eines Remote Operators in einem iterativen Prozess fortlaufend gestaltet und evaluiert. Die so gewonnenen Erkenntnisse sollen auch auf weitere Einsatzfelder im Bahnbereich übertragen werden. Ende 2026 soll der prototypische Arbeitsplatz während einer Testfahrt mit einem autonom fahren Zug zum Einsatz kommen.
Zielgruppe:
Alle Interessenten sind herzlich eingeladen.
Der Pitch zu Beginn des Workshops stellt alle relevanten Kenntnisse dar, die für die Bearbeitung der Aufgaben erforderlich werden.
B07 - TU Dresden

Workstream-Owner:
PD Dr.-Ing. habil. Ulrich Maschek - TU Dresden, Professur für Verkehrssicherungstechnik
Kommissarischer Leiter
Forschungsschwerpunkte:
- Sicherheits- und Risikobetrachtungen für Bahnsysteme
- Technologien und Techniken zur Fahrwegsicherung (Stellwerke)
- Planung von Leit- und Sicherungstechnik (LST)
- Durchgängige digitale Datenhaltung in der LST-Planung
Dr.-Ing. Richard Kahl - TU Dresden, Professur für Verkehrssicherungstechnik
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Forschungsschwerpunkte:
- Technologien und Techniken von Zugbeeinflussungssystemen
- Modellierung von sicherungtechnischen Systemen
- Planung von ETCS
- Automatisierter Bahnbetrieb
Kurzbeschreibung:
Vor zwei Jahren wurde auf der DRC unter dem Titel „ETCS auf Nebenstrecken – RBC neu gedacht“ das LRBC diskutiert, das den Zugleitbetrieb in die ETCS-Welt hebt. Mittlerweile wurde es von den Autoren weiterentwickelt [1]. Bisher wurde immer davon ausgegangen, dass der Anschlussbahnhof mit üblichem ETCS ausgerüstet ist. Als nächstes soll die Transition von PZB zu ETCS mit LRBC betrachtet werden, da das LRBC möglicherweise eingesetzt wird, bevor alle Strecken mit ETCS ausgerüstet sind. Es sollen diesbezüglich Fragen der Transition und Zufahrtsicherung diskutiert werden.
Zielgruppe:
Entwickler, Ausrüster und Betreiber von Eisenbahninfrastruktur, insbesondere mit schwachem Verkehr und einfachem Betriebsprogramm
Grundlegende Funktionsweise von PZB und ETCS
Sprache: DE
B08 - TU Berlin
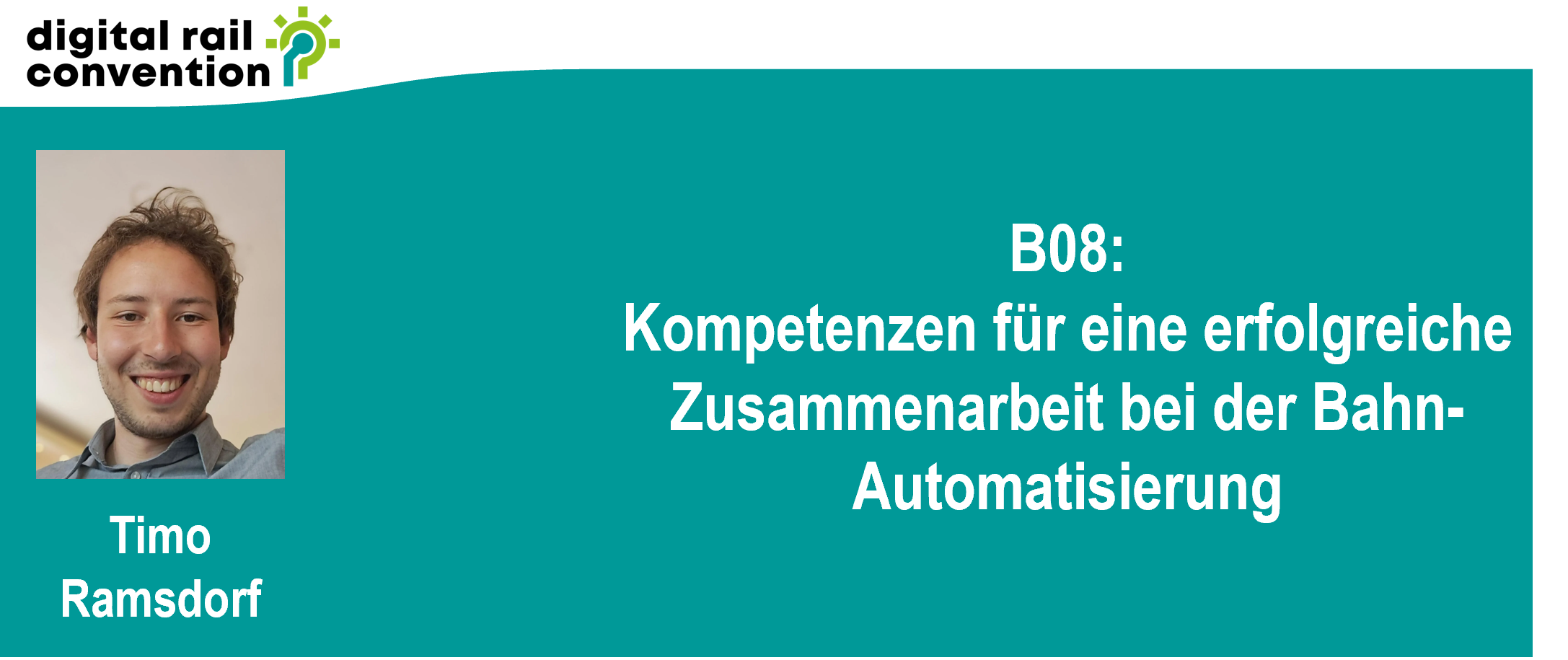
Workstream-Owner:
Timo Ramsdorf - Technische Universität Berlin
Fachgebiet Bahnbetrieb und Infrastruktur
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Position / Aufgaben:
- Lehrveranstaltungen "Digital Rail" und "Praxis des Bahnbetriebs"
- Forschung in Themenbereichen Quantum Key Distribution (QKD) im Bahnbetrieb und dem "Digitalen Befehl"
- Softwareentwicklung für das Eisenbahn Betriebs- und Experimentierfeld (EBuEf)
Kurzbeschreibung:
Um Digitalisierungs- und Automatisierungsprozesse im Bereich des Bahnbetriebs erfolgreich umzusetzen, ist es unbedingt erforderlich, dass Fachleute aus den Bereichen Informatik und Bahnbetrieb gut zusammenarbeiten können. Beide Disziplinen haben unterschiedliche Arbeitsweisen und Herangehensweisen an Probleme, was zu Kommunikationsbarrieren führt. Während Informatiker die speziellen Abstraktionsmuster normalerweise in einem agilen Projektmanagement umsetzen, ist es schwierig, auf diese Weise einen Sicherheitsnachweis für eine Zulassung im Bahnbetrieb zu erbringen. Diese Diskrepanz erschwert eine effektive Zusammenarbeit und kann zu unterschiedlichen Zielvorstellungen und Entwicklungen mit geringem praktischem Nutzen führen. Zudem erfolgt die Ausbildung in beiden Bereichen derzeit weitestgehend getrennt, wodurch ein tiefes Verständnis für die jeweiligen Fachgebiete des anderen fehlt. Es stellt sich daher die Frage, welche spezifischen Kompetenzen für zukünftige Fachkräfte erforderlich sind, um diese Lücke zu schließen und wie diese vermittelt werden können. Das Ziel dieses Workstreams ist es, diese notwendigen Kompetenzen zu identifizieren, die Informatiker und Bahnbetriebler für eine effektive Zusammenarbeit im Bereich der Bahn-Automatisierung benötigen. Es sollen Ideen entwickelt werden, wie ein gemeinsames Verständnis über den jeweils anderen Bereich entstehen kann.
Zunächst wird das Thema eingeführt und kurz die universitätsübergreifende Lehrveranstaltung „Digital Rail“ vorgestellt, die sich ebenfalls in Form von Projekten an Studierende der Informatik und des Eisenbahnwesens richtet. Einige Studierende aus dem Projekt zum Thema „Automatisches Rangieren“, das von der TU Berlin angeboten wird, würden an dem Workstream teilnehmen. Diese hätten dann die Gelegenheit, ihre Ergebnisse und Erfahrungen aus dem Projekt zu präsentieren. Anschließend werden einzelne Schwerpunktthemen in Kleingruppen erarbeitet. Das sind zum Beispiel folgende:
- Welches Wissen über Bahnbetrieb benötigen Informatiker?
- Welches Wissen über Informatik benötigen Eisenbahner?
- Welche Faktoren sind für eine gute Zusammenarbeit entscheidend?
- Braucht es eine vollständig übergreifende Ausbildung? Wenn ja, wie könnte diese aussehen?
Die Ergebnisse werden zusammengetragen. Darauf aufbauend können gemeinsam geeignete Methoden entwickelt werden, um die zuvor erarbeiteten Ziele in der Lehre erreichen zu können. In einem abschließenden Austausch wird ein gemeinsames Fazit formuliert.
Zielgruppe:
Die Zielgruppen des Workstreams sind für die Ausbildung verantwortliche Personen (z.B. Dozierende an Hochschulen und Trainer in den Unternehmen), Studierende selbst und Fachkräfte, die bereits im Bereich der Bahn-Automatisierung arbeiten, und daher Erfahrungen über notwendige Kompetenzen einbringen können.
Vorkenntnisse der Teilnehmenden:
Es sind keine besonderen Vorkenntnisse für die Teilnahme notwendig.
Sprache: DE
B09 - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.

Workstream-Owner:
Prof. Gert Jann Bikker - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.
Institutsdirektor Schienensystemtechnik am DLR Institut für Verkehrssystemtechnik
Wir erforschen Technologien für den intermodal vernetzten sowie automatisierten Verkehr der Zukunft auf Straße und Schiene. In interdisziplinären Teams entwickeln wir hierzu in Braunschweig und Berlin innovative Betriebskonzepte und Methoden. Dafür entwickeln wir im Kontext der Bahnautomatisierung innovative Technologien, Methoden und Konzepte für die Schiene.
Wir betrachten das Gesamtsystem Bahn in der Verknüpfung Infrastruktur – Fahrzeug – Betrieb mit dem Menschen im Mittelpunkt. Wir unterstützen die Einführung digitaler Leit- und Sicherungstechnik mit der Erarbeitung von Teststrategien und -methodiken sowie Automatisierungslösungen für die Testdurchführung.
Wir betrachten das Gesamtsystem Bahn in der Verknüpfung Infrastruktur – Fahrzeug – Betrieb mit dem Menschen im Mittelpunkt. Wir unterstützen die Einführung digitaler Leit- und Sicherungstechnik mit der Erarbeitung von Teststrategien und -methodiken sowie Automatisierungslösungen für die Testdurchführung.
Dr. Caroline Schießl - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.
Institut für Verkehrssystemtechnik (TS)
Dipl.-Psych - Abteilungsleiterin „Informationssysteme und Mobilitätsdienste“
Ziel unserer Forschung ist es, den Verkehr noch mehr an den Bedürfnissen der Menschen auszurichten. Dafür untersuchen wir Reiseketten, optimieren Services und entwickeln wir Technologien. Anhand eines digitalen Zwillings des Menschen simulieren wir, wie Nutzende aktuelle Mobilitätsangebote erleben oder wie sie neue Ideen aufnehmen.
Dr.-Ing. Erik Grunewald - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.
Institut für Verkehrssystemtechnik
Dr. Mandy Dotzauer - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.
Institut für Verkehrssystemtechnik
M.Sc. Human Factors - Gruppenleiterin: Informations- und Interaktionsdesign
Institut für Verkehrssystemtechnik
M.Sc. Human Factors - Gruppenleiterin: Informations- und Interaktionsdesign
Kurzbeschreibung:
Im Rahmen zunehmender Automatisierung werden Szenarien diskutiert, in denen bei Bahnreisen weder Triebfahrzeugführende noch Zugbegleitpersonal den Fahrgästen im Zug zur Seite stehen. Eine der wesentlichen Fragen dabei ist, wie dennoch den vielfältigen Erwartungen und Bedürfnissen der Fahrgäste im Regional- und Fernverkehr entsprochen werden, ein reibungsloser betrieblicher Ablauf sichergestellt und ein hohes Level an Service gewährleistet werden kann.
Das Konzept des Digitalen Zwillings von Reisenden (DZR) wird von uns als ein möglicher Lösungsbaustein erforscht. Wir untersuchen Reiseketten, erfassen, modellieren und simulieren wie Nutzende aktuelle Mobilitätsangebote erleben, neue Ideen / Konzepte aufnehmen.
Sprache: DE
B10 - SWS Digital e. V. & Netzwerkpartner

Workstream-Owner:
Referenten:
Sebastian Seifert - axilaris GmbH
Sebastian Seifert ist strategischer Vertriebsmanager bei der axilaris GmbH aus Chemnitz und bringt eine umfangreiche Expertise aus den Bereichen Digitalisierung und Cybersicherheit mit. Sein Vortrag nimmt das Thema Digitale Resilienz als Rückgrat kritischer Infrastrukturen in den Blick und setzt dabei den inhaltlichen Fokus auf Strategien zur Stärkung von Widerstandsfähigkeit, Reaktionsfähigkeit und nachhaltigem Schutz in einer vernetzten Welt.
Falko Commichau - enviaTEL GmbH
Falko Commichau ist Linienplaner bei der envia TEL GmbH. Seit über 10 Jahren plant und überwacht er die passiven Kapazitäten im Glasfasernetz der enviaM-Gruppe.
Dirk Uebe - AP Sensing
Dirk Uebe ist Business Development Manager Rail bei AP Sensing. Mit über 25 Jahren internationaler Erfahrung in Bahntechnik und Sensortechnik fokussiert er sich auf den Einsatz von Fiber Optic Sensing (FOS) zur kontinuierlichen Überwachung und Absicherung von Bahninfrastrukturen und Fahrzeugen. Im Mittelpunkt stehen dabei Anwendungen wie die Gleiszustandsüberwachung, die Echtzeit-Detektion von Schienenbrüchen sowie die Früherkennung von Defekten in der Rad-Schiene-Kontaktzone.
Christoph Kossmann - ESRA GmbH
Christoph Koßmann ist Projektleiter bei der ESRA GmbH und für die Projektabwicklung, die Angebotserstellung und Neukundenakquise zuständig.
Ronald Sieber - SYS TEC electronic AG
Ronald Sieber ist seit 2019 Vorstand der SYS TEC electronic AG und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Embedded Systemen, Steuerungen und Feldbussen. Mit der sysWORXX-Serie setzt das Unternehmen auf den Ansatz „Security by Design“, um sichere und zuverlässige Lösungen für industrielle Kommunikations- und Steuerungsaufgaben zu realisieren. Alle Baugruppen werden am Unternehmenssitz in Heinsdorfergrund bei Reichenbach gefertigt. Auch hierbei spielen Sicherheitsaspekte eine zentrale Rolle.
Kurzbeschreibung:
13:00 Uhr: Begrüßung und Vorstellungsrunde
13:15 Uhr: "Digitale Resilienz als Rückgrat kritischer Infrastrukturen. Strategien zur Stärkung von Widerstandsfähigkeit, Reaktionsfähigkeit und nachhaltigem Schutz in einer vernetzten Welt“
Sebastian Seifert, axilaris GmbH
13:30 Uhr: „Schutz von Infrastruktur durch Monitoring über Glasfaser“ Falko Commichau, enviaTEL GmbH & Dirk Uebe, AP Sensing, online-Zuschaltung
13:45 Uhr: „Parameterschutz mit KI und Drohnen“
Christoph Kossmann, ESRA GmbH
14:00 Uhr „Anwenderbericht: Herausforderungen eines produzierenden Unternehmens den Kunden Sicherheit zu bieten, gesetzliche Anforderungen zu erfüllen und kosteneffizient zu sein. Übergang zur Diskussion.“
Ronald Sieber, SYS TEC electronic AG
14:15 Uhr: Pause
Sprache: DE
Fachvorträge - Zeit: 15:30 - 16:45
Slot A1 - Pinpoint GmbH
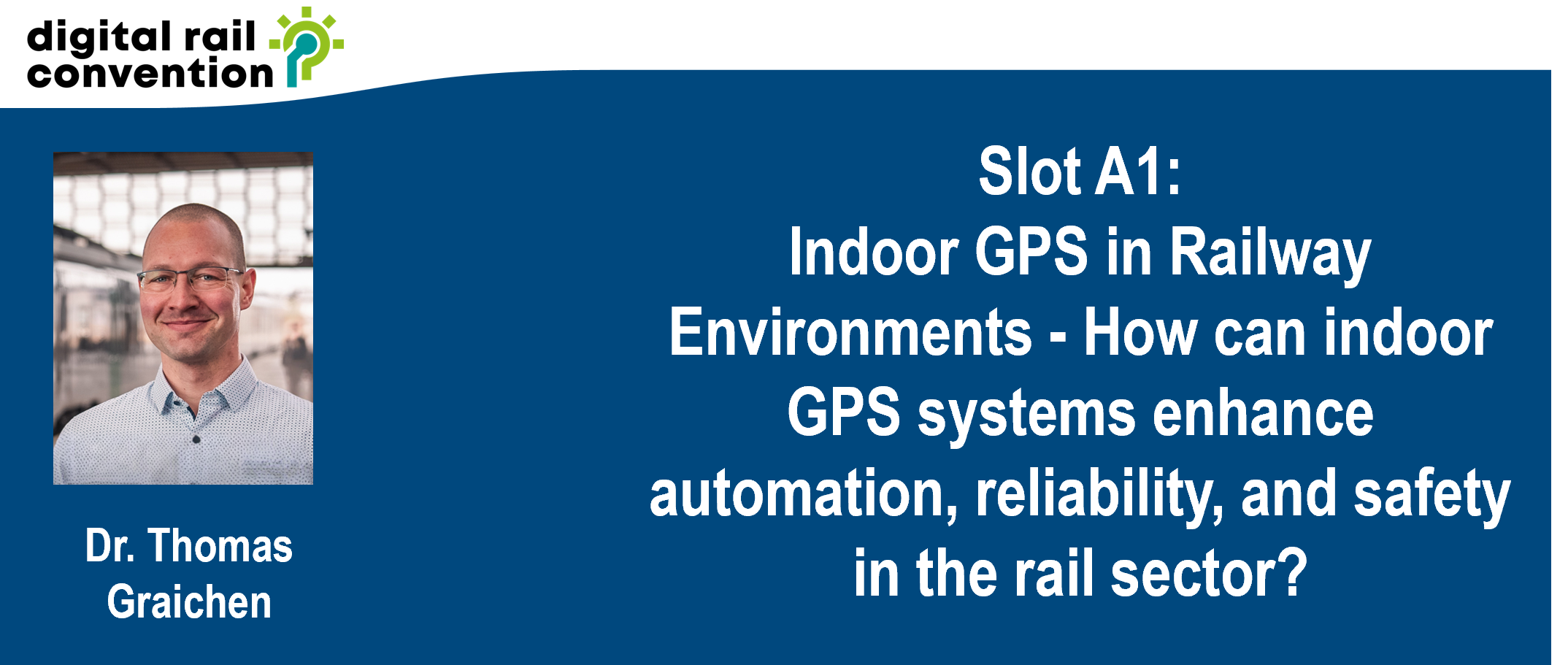
Speaker:
Dr. Thomas Graichen - Pinpoint GmbH
Kurzbeschreibung:
Indoor GPS systems in the railway sector
- How can indoor GPS systems promote automation, reliability, and safety in the railway sector? -
The presentation will begin with an introduction to current indoor and outdoor positioning technologies, highlighting their capabilities and limitations. Then, it will move on to applications. Next, it will present the current challenges in the railway sector that can be overcome with positioning technologies and their technical solutions.
- How can indoor GPS systems promote automation, reliability, and safety in the railway sector? -
The presentation will begin with an introduction to current indoor and outdoor positioning technologies, highlighting their capabilities and limitations. Then, it will move on to applications. Next, it will present the current challenges in the railway sector that can be overcome with positioning technologies and their technical solutions.
Slot A2 - SIGNON Deutschland GmbH
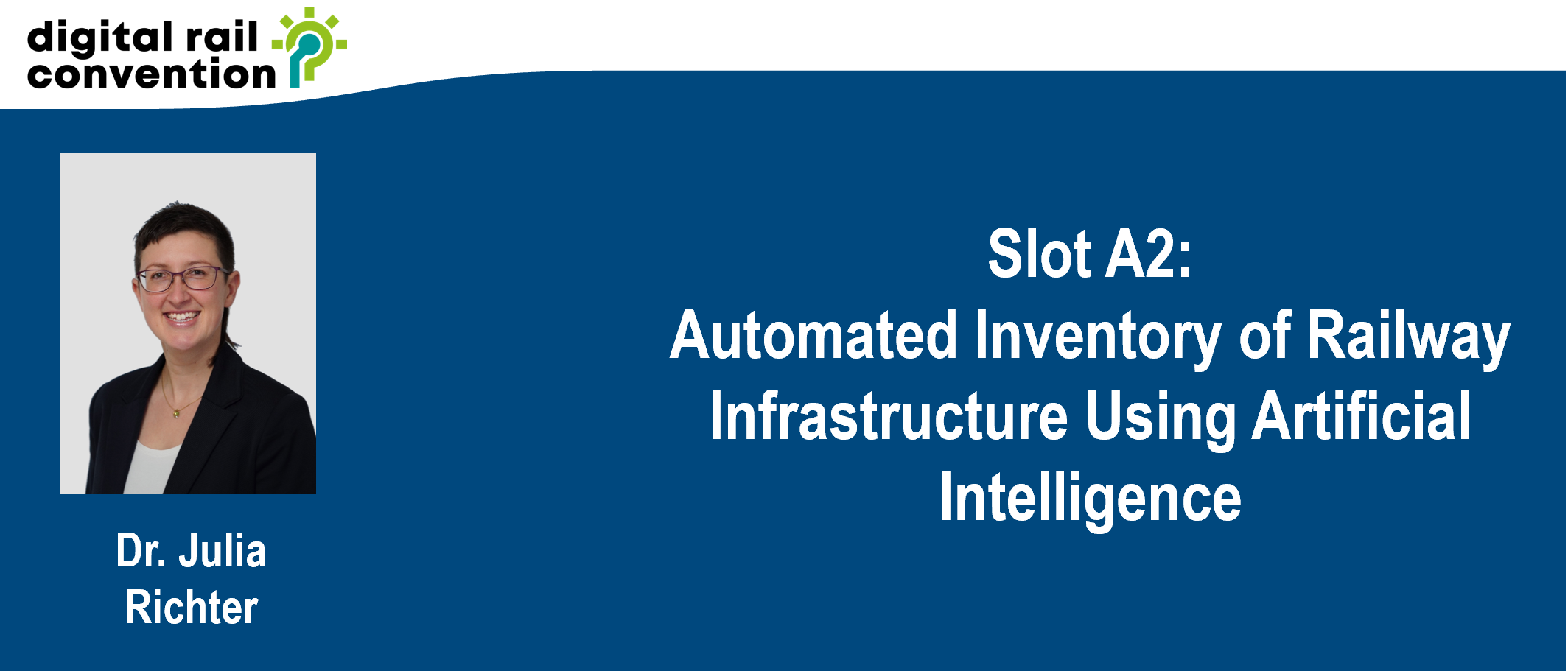
Speaker:
Dr. Julia Richter is a software engineering specialist at SIGNON Deutschland GmbH, a company belonging to Deutsche Bahn AG. She is leading the innovation project “SIGNON InfraAI -Technical Equipment” and works on innovative solutions for AI-supported registration of railway infrastructure.
Kurzbeschreibung:
The automated inventory of railway infrastructure is a prerequisite for the digitization of rail transport. Multisensory data processing and deep neural networks, i.e., artificial intelligence (AI), are key technologies in the development of reliable recording systems. Until now, railway infrastructure has been recorded by means of on-site track inspections or manual data analysis of recorded track data. This involves track closures and enormous amounts of time required for walking the tracks or completely reviewing the data material. These methods do not scale with the size of the route network to be recorded, are prone to errors, and cannot be managed with the available human and time resources.
In this context, SIGNON GmbH is working on innovative solutions for the automated registration of railway infrastructure directly from multisensory track recordings. The new approaches and solutions will be presented in the talk.
The registration of elements such as catenary poles, axle counters, and ETCS balises is based on multi-sensor data such as panorama images, point clouds, and GPS. This data is collected during measurement campaigns, which can be integrated into regular rail operations due to their appropriately high speed. Automatic recognition is made possible using deep neural networks. This AI is trained using data sets created by experts and tested for reliability so that it can then independently recognize and locate objects and their properties in the point clouds.
The use of such an AI enables a comprehensive and reliable inventory of infrastructure data and lays the foundation for efficient and sustainable digitization of railway infrastructure.
The use of such an AI enables a comprehensive and reliable inventory of infrastructure data and lays the foundation for efficient and sustainable digitization of railway infrastructure.
Slot B1 - Westsächsiche Hochschule Zwickau
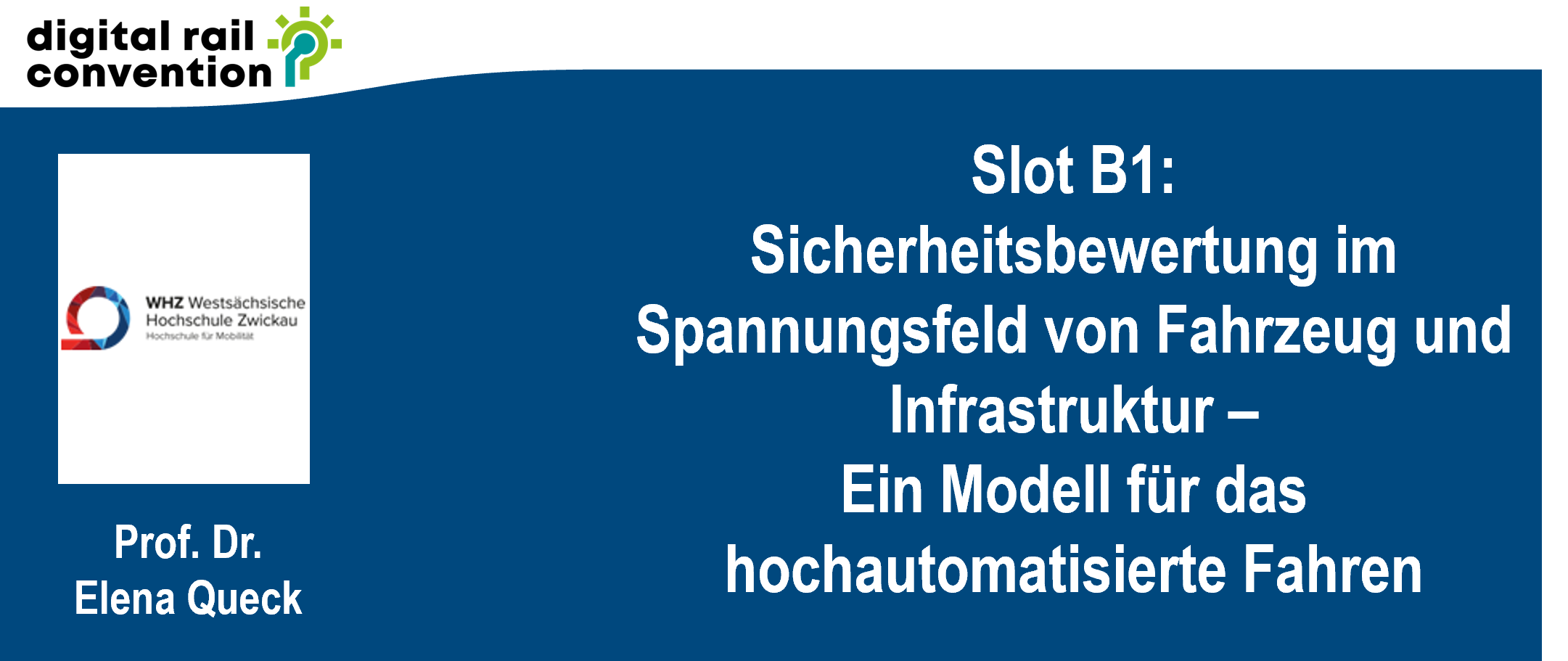
Speaker:
Prof. Elena Queck - Westsächsiche Hochschule Zwickau
Professur Verkehrssteuerung und Verkehrsinfrastruktur
Fakultät Kraftfahrzeugtechnik
Fakultät Kraftfahrzeugtechnik
Kurzbeschreibung:
Aktuelle Entwicklungen im Bereich des hoch- und vollautomatisierten Fahrens zeigen, dass bei der Implementierung von teil- und hochautomatisierten Fahrfunktionen in aktuelle Verkehrssysteme große Schwierigkeiten auftreten. Diese Schwierigkeiten basieren vor allem auf den komplexen, durch das Fahrzeug schwer beherrschbaren, infrastrukturell bedingten Gegebenheiten. So ist zum einen unklar ob und mit welchen Systemgrenzen ein Fahrzeug in welcher Infrastruktur unter einem gegebenen Akzeptanz- und bzw. Sicherheitslevel zulässig ist. Zum anderen ist ungeklärt, welche Maßnahmen von Fahrzeug- und Infrastrukturbetreibern ergriffen werden müssen, um neu zu definierende Zulassungsvoraussetzungen beiderseitig erfüllen zu können.
Ziel ist es, ein allgemein anwendbares Sicherheits-Bewertungsmodell zu erstellen und prototypisch umzusetzen, welches unter Berücksichtigung vorhandener Datenbanken und durch Erstellung neuer Datenquellen in der Lage ist, die Abhängigkeiten eines komplexen Verkehrssystems abzubilden. Ferner soll dieses Modell Aussagen zur Einordnung bestehender und zur Ableitung notwendiger Maßnahmen an Infrastruktur, menschlichem Verhalten, Fahrzeugsysteme- oder Verkehrssystemen Verkehrsprozess treffen können. Dieses Modell dient in der Anwendung Fahrzeugherstellen und Infrastrukturbetreibern als Grundlage zur zukünftigen Gestaltung kooperativer Fahrzeug- und Verkehrssysteme für das sichere teil- und hochautomatisierte Fahren.
Zielgruppe:
Verkehrsunternehmen, Infrastrukturunternehmen, Industrie, Fahrzeughersteller, Kommunen, Tiefbauämter
Slot B2 - PhySens Rail GmbH
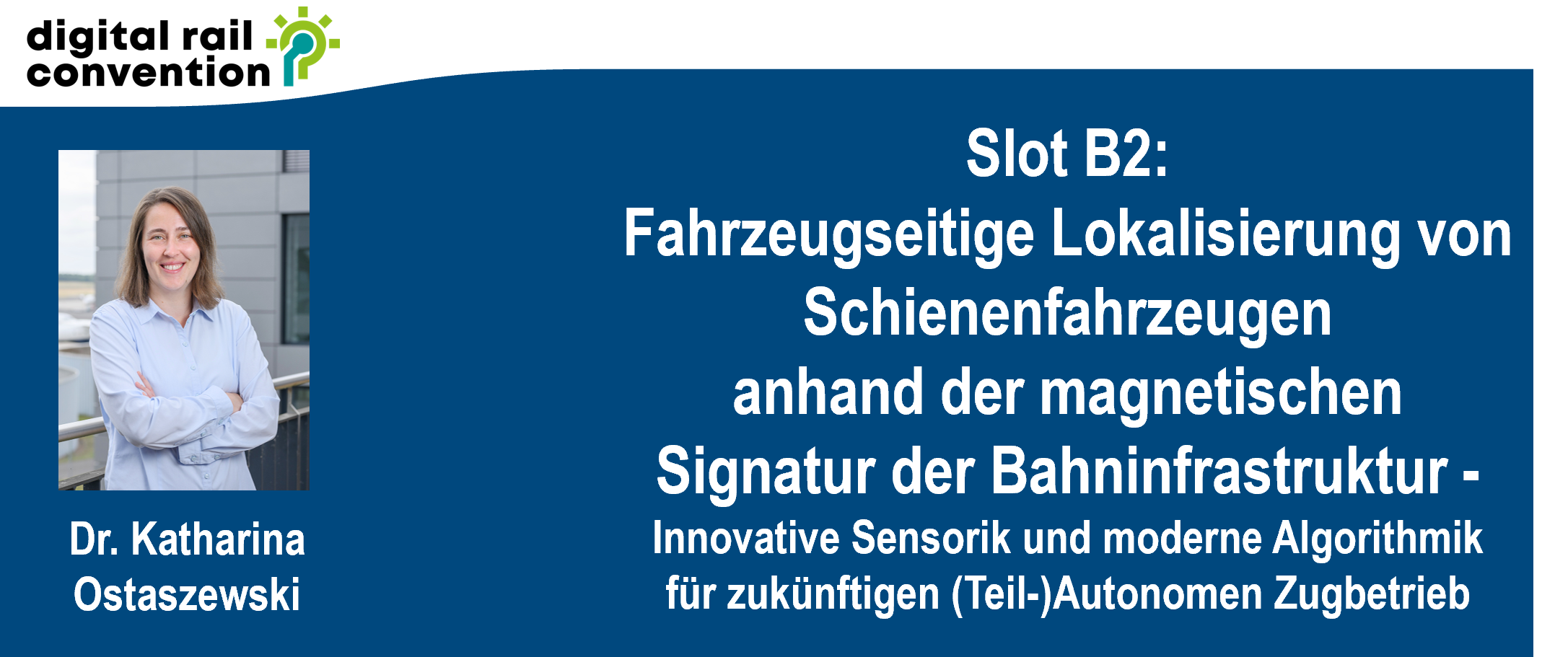
Speaker:
Dr. Katharina Ostaszewski - PhySens Rail GmbH
Geschäftsführerin
Thema des Vortrags ist die neuartige magnetfeldbasierte Technologie zur fahrzeugseitigen Echtzeitlokalisierung. Vorgestellt werden der aktuelle Entwicklungsstand, die Vor- und Nachteile im Vergleich zu anderen bekannten Lokalisierungsmethoden (z. B. GNSS) sowie konkrete Anwendungszenarien. Die Erkenntnisse und Entwicklungen basieren auf dem abgeschlossenen FL1 mFUND-Projekt (MZLS, FKZ: 19F1128) sowie einem derzeit in der Beantragung befindlichen mFUND FL2-Projekt.
Das Ziel des Vortrags ist es, das Publikum für diese innovative Technologie und ihre Einsatzmöglichkeiten zu sensibilisieren und die damit verbundenen Potenziale für die weitere Automatisierung des Schienenverkehrs zu diskutieren.
Konkret zum Forschungsprojekt:
Die fahrzeugseitige Echtzeitlokalisierung ist eine Voraussetzung zur Effizienzsteigerung im Schienenverkehr. Aufgrund fehlender Zuverlässigkeit bestehender Systeme oder der Notwendigkeit von infrastrukturseitiger Sensorik können Konzepte wie das Moving Block-Verfahren bislang nicht umgesetzt werden. Potenzielle Technologien, z.B. GNSS, besitzen Schwächen und können daher nicht alleinstehend eingesetzt werden. Derzeit befindet sich keine fahrzeugseitige Echtzeitlokalisierung im operativen Einsatz.
Ziel des Projekts ist die Erprobung eines Gesamtsystems zur magnetfeldbasierten Echtzeitlokalisierung unter Betriebsbedingungen und die Integration in den regulären Betriebsablauf. Dazu soll eine Systemarchitektur zum Roll-out und zur Aktualisierung von magnetischen Karten entwickelt werden. Anschließend soll die Verwendung der präzisen Positionsdaten in verschiedenen praxisnahen Anwendungen getestet werden.
Vorkenntnisse der Teilnehmenden:
Dr. Katharina Ostaszewski - PhySens Rail GmbH
Geschäftsführerin
- Studium der Physik und Informatik an der Technischen Universität Braunschweig (TU BS)
- Promotion in Physik an der TU BS im Bereich der Weltraumsensorik und Plasmasimulation, Teil der ESA-Rosetta Mission
- Ausgründung aus der TU BS im Bereich Messtechnik in 2021, seitdem Teil der Geschäftsführung
- Primär verantwortlich für Softwareentwicklung, Datenanalyse und fachliche Projektleitung im Unternehmen
Thema des Vortrags ist die neuartige magnetfeldbasierte Technologie zur fahrzeugseitigen Echtzeitlokalisierung. Vorgestellt werden der aktuelle Entwicklungsstand, die Vor- und Nachteile im Vergleich zu anderen bekannten Lokalisierungsmethoden (z. B. GNSS) sowie konkrete Anwendungszenarien. Die Erkenntnisse und Entwicklungen basieren auf dem abgeschlossenen FL1 mFUND-Projekt (MZLS, FKZ: 19F1128) sowie einem derzeit in der Beantragung befindlichen mFUND FL2-Projekt.
Das Ziel des Vortrags ist es, das Publikum für diese innovative Technologie und ihre Einsatzmöglichkeiten zu sensibilisieren und die damit verbundenen Potenziale für die weitere Automatisierung des Schienenverkehrs zu diskutieren.
Konkret zum Forschungsprojekt:
Die fahrzeugseitige Echtzeitlokalisierung ist eine Voraussetzung zur Effizienzsteigerung im Schienenverkehr. Aufgrund fehlender Zuverlässigkeit bestehender Systeme oder der Notwendigkeit von infrastrukturseitiger Sensorik können Konzepte wie das Moving Block-Verfahren bislang nicht umgesetzt werden. Potenzielle Technologien, z.B. GNSS, besitzen Schwächen und können daher nicht alleinstehend eingesetzt werden. Derzeit befindet sich keine fahrzeugseitige Echtzeitlokalisierung im operativen Einsatz.
Ziel des Projekts ist die Erprobung eines Gesamtsystems zur magnetfeldbasierten Echtzeitlokalisierung unter Betriebsbedingungen und die Integration in den regulären Betriebsablauf. Dazu soll eine Systemarchitektur zum Roll-out und zur Aktualisierung von magnetischen Karten entwickelt werden. Anschließend soll die Verwendung der präzisen Positionsdaten in verschiedenen praxisnahen Anwendungen getestet werden.
Informationen zu verwandten Aktivitäten des Konsortiums:
Zielgruppe:
Wissenschaftliche Partner aus dem Bahnbereich, Fahrzeughersteller, Interessierte aus dem Bereich batterieelektrische Züge
Grundlegendes Verständnis von Bahntechnik hilfreich; abhängig von der Zuhörerschaft können Sprache und Inhalte in Teilen angepasst werden.
Sprache: DE
Slot C1 - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. & d-fine GmbH
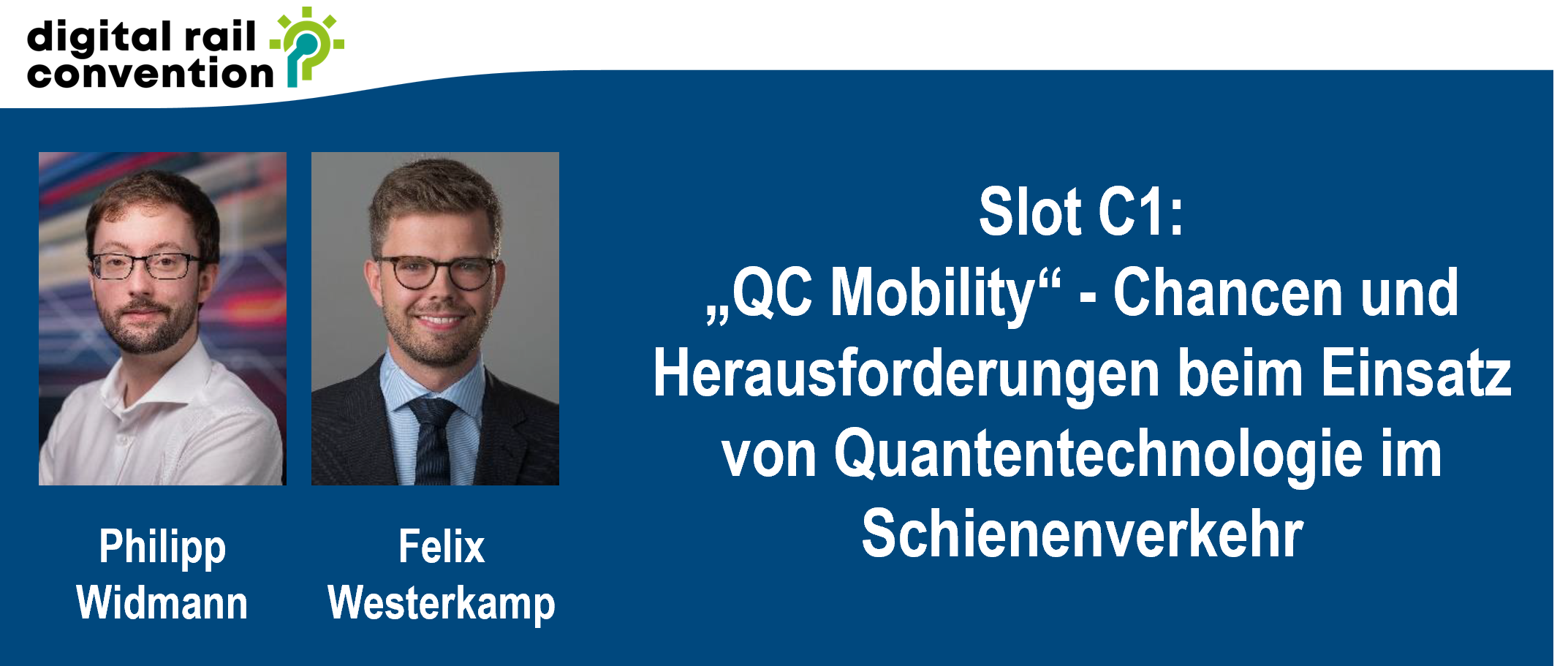
Speaker:
Philipp Widmann - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.
Institut für Verkehrssystemtechnik
Philipp Widmann ist seit 2023 in der Fachgruppe Bahnbetrieb des DLR-Instituts für Verkehrssystemtechnik als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig, nachdem er zuvor sein Studium der Mathematik an der Technischen Universität München erfolgreich abgeschlossen hat. Seine Forschungsinteressen beschäftigen sich vorwiegend mit Optimierungsfragestellungen im Bereich der Fahrplanung und des Zugroutings.
Felix Westerkamp - d-fine GmbH
Felix Westerkamp arbeitet seit über fünf Jahren bei d-fine in dem Bereich Mobilität und Transport mit Fokus auf dem Schienenverkehr. Hier unterstützt er Kunden bei der Konzeption und Umsetzung innovativer datenbasierter Lösungen von der Implementierung intelligenter Dispositionslösungen bis hin zum Einsatz von Quanten-Computing im Schienenverkehr.
Kurzbeschreibung:
Quantencomputing verspricht grundlegende Veränderungen und Leistungspotentiale für komplexe und zeitaufwendige Fragestellungen in verschiedenen Anwendungsbereichen in Wirtschaft und Gesellschaft.
Doch wo im Schienenverkehr braucht man diese Technologie am Dringendsten? Wo könnte sie große Wirkungen erzielen? Welche Anwendungsszenarien sind geeignet? Und worin liegen besondere Herausforderungen?
Das DLR und d-fine nähern sich diesen Fragen aus Eisenbahnperspektive, geben einen Einblick in das laufende Forschungsprojekt QC Mobility – Schienenverkehr der DLR Quantencomputing-Initiative (QCI) und laden in einem interaktiven Teil zur Diskussion ein.
Sprache: DE
Slot C2 - Vodafone GmbH

Speaker:
Ingo Willimowski - Vodafone GmbHVodafone Business, Principal Customer Solution Architect
Dipl.-Ing. Ingo Willimowski stammt aus dem Erzgebirge begann seine berufliche Laufbahn 1993 in einem Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt Funktechnik. Im Jahr 2008 kam er zu Vodafone, wo er zunächst im Technik- und später im Geschäftskundenbereich sowie in den Vodafone Innovation Park Labs tätig war und komplexe Lösungen für Groß- und Geschäftskunden entwickelte und implementierte. Seit 2021 ist er in der Rolle des Principal Customer Solution Architect bei Vodafone Business tätig, wo er als Lead Architect für 5G Business Solutions in Deutschland für die strategische Entwicklung von 5G, Mobile Private Networks (MPN) und Mission Critical Communication (MCx) für Geschäftskunden verantwortlich ist. Er hatte verschiedene Lehraufträge an mehreren Universitäten inne, ein Fachbuch sowie zahlreiche Artikel, Konferenzbeiträge und Buchkapitel veröffentlicht und hält mehrere Patente. Er ist seit 2018 an der Errichtung der 5G Infrastruktur für die Bahnforschung an der Strecke zwischen Schwarzenberg und Annaberg-Buchholz als Customer Solution Architect beteiligt.
Online Profil: https://www.linkedin.com/in/ingo-willimowski/
Kurzbeschreibung:
Die Technik der Mobilfunknetze entwickelt sich rasant – mit 5G sind nun innovative Technologien verfügbar, welche bei der Eisenbahn und industriellen Anwendungen eingesetzt werden können. Im Vortrag werden einige dieser neuen Möglichkeiten, wie 5G Network Slicing, Mobile Private Networks (MPN), Mission Critical Communication MCx) und Non-Terrestrial Networks/Satellite Communication (NTN) im Überblick vorgestellt .
.